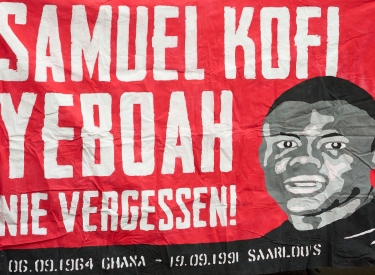Platz der Verlierer
Die DDR ist hier immer noch präsent. Nahe des Halleschen Tores in Kreuzberg, am Waterlooufer, steht bis heute ein unscheinbarer Billigbungalow, den die Bürger aus Berlin-West aufsuchen mußten, um ein Visum zu beantragen und zu erhalten, wenn sie nach Berlin-Hauptstadt wollten.
Die DDR-Behörden hatten ihren häßlichen Bungalow nicht zufällig hier hingestellt. Er stand kurz hinter dem Mehringplatz, einem kreisrunden architektonischen Experiment, das städtebaulich dafür sorgte, daß die Ostberliner Friedrichstraße, die nur wenig in den Westen verlängert war, endlich ein Ende hatte.
Mehringplatz und Landwehrkanal waren kulturell betrachtet das Westberliner Pendant zur Mauer. Hier begann das von Berlinzulage und Frontstadtimage geprägte Leben. (Das wußten auch die Westbehörden, die den Bungalow später zur Asylbewerberabwimmelung benutzten.)
Die Gegend rund um das Hallesche Tor hatte alles, was Westberlin zu DDR-Zeiten charakterisierte: Das Hertie, wo es alles zu kaufen gab, die gut sortierte Amerika-Gedenkbibliothek, die ein Geschenk der US-Regierung war, die Post, von der aus man das Päckchen nach drüben schicken konnte, und seit wenigen Jahren auch das Redaktionsgebäude der Stadtillustrierten zitty.
Am vergangenen Freitag, den 12. März, hat nun das Hertie dichtgemacht. Von den 140 Beschäftigten werden 100 entlassen.
Neun Jahre zuvor hatte schon die DDR dichtgemacht, und was aus den Grenzbeamten, oder wie man solche Leute nannte, die täglich in den süßen Kleinbussen angekarrt wurden, um Westbürgern auf Westterritorium Visa auszustellen, weiß ich nicht. Zum Betreten von Ostberlin brauche ich jedenfalls heutzutage kein Visum mehr.
Auch die Amerika-Gedenkbibliothek wurde umgemodelt, sie heißt jetzt auch ganz anders, und ihr Bestand an Sportbüchern, der mich halt interessierte, ist in den Ostteil der Stadt transportiert worden. In einigen Jahren soll das Gebäude sogar ganz geschlossen werden und die AGB zusammen mit der Berliner Stadtbibliothek in einen Neubau am Schloßplatz ziehen. Die zitty erscheint zwar weiterhin, nur ich lese sie nicht mehr, und einzig die Post, deren Monopol ja bekanntlich auch ausläuft, zwingt mich noch manchmal, am Halleschen Tor Einschreiben oder nicht in den Briefkasten passende Büchersendungen abzuholen.
Früher gab es also mehr Gründe, zum Halleschen Tor zu fahren. Und seit Hertie dichtgemacht hat, ist die Gegend noch weniger interessant geworden. Im letzten Jahr hatte das Hertie-Haus am am Blücherplatz noch sein hundertjähriges Jubiläum gefeiert, aber da stand schon fest, daß der Laden geschlossen wird, und also war nicht viel zu feiern.
In den letzten Wochen gab es jede Menge Rabatte auf alle Waren, und der ohnehin eher als Billigmarkt verschrieene Hertie wurde vermehrt zur Kopftuchdrängelzone. "Der Umsatz brach weg, der Standort war zu unattraktiv, und immer mehr Kunden liefen weg", begründete ein Hertie-Sprecher die Schließung.
Demnächst kommt hier die "Domäne" rein, die vor allem Teppiche verkauft. Dann sollen, so ließ die Unternehmensleitung verlauten, in dem Haus mit neuer Fassade weiterhin Lebensmittel verkauft werden, und zwar nach dem Markthallenprinzip. Das heißt, es wird Obst- und Gemüsestände geben, ein Mister-Minit-Dienst wird bleiben, wie auch die Änderungsschneiderei. Aber eben kein Kaufhaus mehr.
Bundesweit, so habe ich nachgelesen, haben Kaufhäuser einen Anteil am Einzelhandelsumsatz von etwa fünf Prozent, in Berlin seien es noch 16 bis 17 Prozent. Wenn in Berlin schon einige Hertie-Filialen geschlossen oder umgewandelt wurden - in diesem Jahr wird noch der Hertie im Märkischen Viertel dichtgemacht - sei das die gleiche Entwicklung, die andere Städte schon vor Jahren durchgemacht hatten.
Das wird schon stimmen, aber daß es gerade das eigentlich günstig gelegene Hertie am Blücherplatz erwischte, hat noch mehr Gründe.
Dieses Kaufhaus, die bei ihm gelegene U-Bahn-Station, an der schon Billy Wilder drehte, die Amerika-Gedenkbibliothek, die Westberliner Stadtillustrierte und vor allem der Mehringplatz - sie alle repräsentierten das richtige Westberlin. Nach dem Ende der DDR wandelte sich aber auch Kreuzberg vom Rand- zum zentralen Bezirk. Vor allem die Gegend um den Landwehrkanal ist mittlerweile feinste Wohnlage, in der ein Markthallenangebot dem Kaufverhalten eher entspricht als ein Billigwarenhaus, zumal nur knapp einen Kilometer entfernt mit dem Fox-Markt ein echter Discountladen steht, der sich in die Schnäppchen-Meile Kottbusser Damm einpaßt.
Der Landwehrkanal wird mehr Wohngegend denn Einkaufs- oder gar Fabrikgegend. Zum Einkaufen fährt man in die Lagen, die von Immobilienhändlern als "Eins-a-Gegend" kategorisiert werden: Kudamm und Tauentzien in Charlottenburg, die Schloßstraße in Steglitz, die Wilmersdorfer Straße, in verstärktem Maße die Friedrichstraße, die Neuköllner Karl-Marx-Straße, der Alexanderplatz und die Müllerstraße im Wedding. Die bessere Kundschaft in den Randbezirken sucht wahlweise die Gorkistraße in Tegel, den Teltower Damm in Zehlendorf oder die Carl-Schurz-Straße in Spandau auf.
Interessanterweise werden bis auf die Nobelgegenden Friedrichstraße, Alex und Unter den Linden von den Maklern keine Ostbezirke genannt, auch keine Straße im Prenzlauer Berg. Die Kaufkraft ist im Westen geblieben, bzw. ist sogar im Westen relativ stärker geworden, denn die Klientel, die bislang mehrheitlich in Kreuzberg lebte, viele Studenten etwa, verzieht immer mehr nach Lichtenberg und Friedrichshain, wo die Mieten günstiger sind und sich auch die billigeren Geschäfte ansiedeln. Der Begriff "Kreuzberger Mischung", der von sozialdemokratischen Bezirkspolitikern zum Lob eines funktionierenden Zusammenlebens von Ausländern und Deutschen erfunden wurde, beschrieb immer auch eine soziale Balance, die Gut- und Besserverdienende neben Sozialhilfeempfängern verträglich leben ließ, und deren Voraussetzung ein starker Wohlfahrtsstaat war, den es in Westberlin immer gegeben hatte. Mit dem Ende der DDR endete eben auch diese Besonderheit Westberlins.
Gesamtberlinerisch berechnet fehlt den hiesigen Haushalten durchschnittlich ein Monatseinkommen pro Jahr. Genauer betrachtet ist die Schere zwischen den leidlich besser Verdienenden, die sich der früher von allen bewohnten Bezirke langsam bemächtigen, und denen, die Probleme bekommen, ihre Miete zu zahlen, deren Stammkneipe geschlossen wurde, weil da Boutiquen und Schuhgeschäfte drin sind, weit aufgegangen.
Wie die Kneipe, so das Hertie. Das Kaufhaus am Blücherplatz war auf einmal zu billig für Neu-Kreuzberger Ansprüche. Um aber auf diese abgestimmt zu sein, das heißt nicht nur attraktiv, sondern auch städtebaulich und kulturell an die Nobelmeilen wie Kudamm oder Friedrichstraße angebunden zu sein, müßte man ihn aufwendig modernisieren. Das aber klappt nicht, denn da steht ja das alte Westberliner Relikt Mehringplatz, jene architektonische Sperre zwischen Friedrichstraße und Mehringdamm.
Deswegen ist die DDR am Halleschen Tor bis heute präsent. Deswegen sind dort mit der von der Verlegung nach Mitte bedrohten Amerika-Gedenkbibliothek, der vor der Privatisierung stehenden Post, der nur im Westen gelesenen zitty, dem nutzlos rumstehenden DDR-Visastellen-Bungalow und dem gerade geschlossenen Hertie lauter Symbole historischer Verlierer versammelt.
Unweit, übrigens, ist auch die neue Bundesgeschäftsstelle der SPD.



 Mit gelöster Bremse
Mit gelöster Bremse