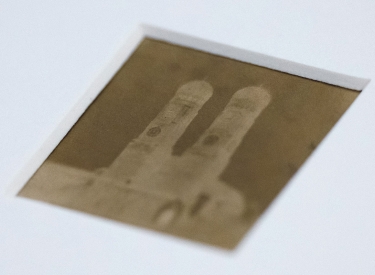Dogma light
Was Lars von Trier früher zur Filmtheorie losgelassen hat, hörte sich meist so an: "Ein Film sollte sein wie ein Stein im Schuh. Prost." Seit dieser Aussage in seinem "Epidemic" von 1987 sind allerdings zwölf Jahre vergangen. Und zehn neue Regeln hinzugekommen. Was als Treppenwitz der Filmgeschichte an einem Kopenhagener Sommerabend begann, ist heute die heilige Schrift der Cineasten, aus der im Zoo-Palast wie im Arsenal ehrfurchtsvoll zitiert wird.
Das "Dogma 95", "die zehn Regeln des zeitgenössischen Filmemachens", wurde dabei erst durch einen klug inszenierten Werbefeldzug in Cannes 1998 zum Thema, als der an einer Reiseklaustrophobie leidende Lars von Trier medienwirksam im Auto vom Kollegen Thomas Vinterberg ("Das Fest") anreiste und beim Einmarsch in den Filmpalast die "Internationale" aufspielen ließ.
Bei der Vorstellung von Sören Kragh-Jacobsens "Mifune - Dogme 3" blieb es zwar musikalisch ruhig, doch die Dogma-Welle hat nun auch die Berlinale erreicht. Dahinter steckt die simple Überlegung von Festival-Chef Moritz de Hadeln: Was an der Croisette die Leute entzückt hat, kann im februarkalten Berlin so schlecht nicht sein. "Mifune" beweist, daß die zehn Dogmen (natürliches Licht, Handkamera, Originalschauplätze, -musik usw.) zu ganz amüsanten Ergebnissen führen können. Aus der Kombination klassisch skandinavischer Themen wie kaputte Ehen und Scheidungskriege, Vater-und-Sohn-Geschichten und Geschwisterliebe macht Kragh-Jacobsen etwas, was man zunächst nicht erwarten konnte: eine leichte Sommerkomödie, über die das Berlinale-Publikum um so mehr lachte.
"Das Dogma hat mich zu einer befreiten Arbeitsweise zurückgebracht", meint der Regisseur. Was ihm diejenigen aufs Wort glauben, die sich noch an seinen metaphernschweren Berlinale-Beitrag "The Island on Bird Street" von 1997 erinnern können. In "Mifune" sieht man Männer vorzugsweise ohne Hosen herumlaufen, aber dafür fast ins nächste Handy kotzen. Dogma light.
Der Wirbel um die Dogmatiker verdeckt allerdings eine Entwicklung, die das gesamte skandinavische Kino erfaßt hat. Die Zeiten richtungweisender amerikanischer Independents und des Schnipsel-Kinos aus Asien scheinen vorerst vorbei zu sein, zumindest wenn die Berlinale als Maßstab gelten kann. Die wirklichen Renner kommen nun aus Dänemark, Norwegen, Schweden und Finnland. Wer hätte das vorhergesehen?
In der Panorama-Sektion lief der Debütfilm "Schpaa" von Erik Poppe. Wochenlang an der Spitze der norwegischen Charts, löste er als "Quasi-Dokument" über die Situation norwegischer Jugendlicher eine lebhafte Debatte aus, die sogar das Familienministerium erreichte, das eine Extravorführung für Schulklassen ansetzte.
Der Film erzählt die Geschichte der Gang des 13jährigen Jonas und seines jugoslawischen Freundes Emir. "Schpaa" (norwegisch für "cool") ist der Begriff, um den sich ihr Leben dreht. Und der sie verleitet, Aufträge aus dem Drogenmilieu anzunehmen, von denen sie besser die Finger gelassen hätten. So kommt es zu einer folgenschweren Verwechslung: Einem kaputten Junkie, dem sie eins aufs Dach geben sollten, schenken sie ein dickes Päckchen Heroin, während sie dem eigentlichen Adressaten, einem Osloer Mafia-Boß, kräftig auf die Mütze hauen. Kein Wunder, daß sie Unruhe in der Unterwelt erzeugen.
Obwohl der Film in Oslo spielt, ist die norwegische Hauptstadt selbst für Skandinavien-Spezialisten nur schwer zu erkennen. "Mit Absicht, denn ich wollte zeigen, daß der Film in jeder anderen europäischen Großstadt hätte spielen können", sagt Erik Poppe. Die Story an sich ist eigentlich nichts Neues, alles schon das eine oder andere Mal gesehen. Und doch ist "Schpaa" all das, was der verunglückte türkisch-deutsche "Dealer" von Thomas Arslan hätte sein können. Zwar ist "Schpaa" in Videoclip-
Ästhetik verpackt, zeigt jedoch nachdrücklich eine hilflose Elterngeneration, deren Werte die nächste Generation nicht mehr erreichen.
Unerreichbar für die gutgemeinten Ratschläge der Eltern ist in dem dänischen "Fucking Amal" auch die 16jährige Agnes. Obwohl schon über anderthalb Jahre in der Kleinstadt Amal, ist die coole Mädchenclique in ihrer Klasse für sie immer noch eine geschlossene Gesellschaft. Agnes ist eine Außenseiterin. Und dann verliebt sie sich ausgerechnet in Elin, hinter der so ziemlich alle Jungen der Schule her sind. "Manchmal sind diejenigen, die in der Schule beliebt waren, später im Leben die größten Loser", versucht Agnes' Vater seine Tochter zu trösten. Was ihm nicht recht gelingt. Als ob das Leben der Eltern sie interessieren würde.
Und während Elin also von einer Modelkarriere und einem "echt geilen" Rave träumt, wandelt Agnes hart am Rande des Selbstmords. Der Debütfilm des 29jährigen Lukas Moodysson erinnert in seiner Ästhetik schwer an die Dogma-Regeln, kommt aber ganz ohne deren theoretischen Ballast aus. In nur 30 Tagen abgedreht und überwiegend mit Laiendarstellern besetzt, konzentriert sich "Fucking Amal" ganz auf die behutsame Annäherung der beiden Mädchen. Und im Bruch mit gesellschaftlichen Konventionen wird die Elterngeneration mal wieder vor den Kopf gestoßen.
Gemeinsam ist vielen skandinavischen Filmen: Kinder, im besten Falle Jugendliche, mißachten Traditionen und machen sich auf die Suche nach dem Neuen. Das war besonders gut auf dem Kinderfilmfest zu beobachten. In dem schwedischen Beitrag "Stjärnsystrar" ("Sternenkinder") droht eine Frau nach dem Tod ihres Mannes in Apathie zu versinken. Erst durch ihr Kind, das einen Koffer mit Andenken anschleppt, lernt sie den Verlust zu akzeptieren.
Ganz ähnlich funktioniert das in dem norwegischen "Bare Skyer beveger Stjernene" ("Nur Wolken können die Sterne bewegen"). Hier schafft es die kleine Maria, nicht nur den Tod des Bruders wegzustecken, sondern auch, ihre Mutter zu resozialisieren. Klassische Kinderfilme im Stile des "Fliegenden Klassenzimmers" will niemand mehr. "Filme für Kinder" oder "Familienfilme", die dem Erwachsenwerden von Kindern zuschauen, sind dagegen schwer im Kommen. Eine Entwicklung, die bis in das "Erwachsenenkino" hinein reicht.
In dieser Sparte ist auf der Berlinale traditionell der Finne Aki Kaurismäki vertreten. Der Lakoniker zeigt diesmal seinen schönen Stummfilm "Juha". Wenn Kaurismäki fehlt, fehlt was. So wie im letzten Jahr, als er seinen Film "Wolken ziehen vorüber" in Venedig präsentierte. Diesmal war er wieder da, und das Publikum dankte es ihm und bildete die längsten Warteschlangen des Festivals. Dabei ist er mit seinem Rückgriff auf die filmtechnische Pionierzeit eher der Außenseiter unter den Filmemachern aus dem Norden. "Juha" verblaßt etwas angesichts der Gegenwartsnähe, die die Filme von Erik Poppe oder Lukas Moodysson prägen.