Supporting Dayton
"Transit, transit" rufend wehrt der Fahrer alle Haltewünsche ab. Nein, der Bus stoppt nicht in Sarajevo. Auf der Fahrt aus dem Erholungsort Pale, der einstigen Hochburg von Radovan Karadzic, nach Kula, beide im serbischen Teil Bosniens gelegen, ist in der Hauptstadt der geteilten Republik kein Zwischenstopp vorgesehen.
Der Busfahrer hält erst zwei Meter hinter dem Ortsausgangsschild von Sarajevo. "Turkish" sagt er, als er mit dem Finger auf die im Miljeka-Tal liegende Hauptstadt herunterzeigt, und steht auf. An seinen Sitz gelehnt, weist er geradeaus den Berg hinauf, Richtung Kula. "Serbish", sagt er nur, dann erst öffnet er die Tür.
Als sei es ein fremdes Land, umfährt der Fahrer die kroatisch-muslimische Föderation - die Endstation heißt Srpska. Bald drei Jahre nach dem formellen Friedensschluß von Dayton steht er damit nicht allein. Auch wenn die Grenzpfosten zwischen der serbischen Republik und der Föderation gefallen sind, hält die Spaltung des Adria-Staates an. Die meisten Direktbusse zwischen Sarajevo und Pale - UNHCR leuchtet es weiß auf den marineblauen Karosserien - werden von der mit dem Dayton-Vertrag installierten internationalen Bosnien-Verwaltung gestellt; nach Banja Luka, der neuen Hauptstadt der Republika Srpska, verkehren Busse nur zweimal täglich.
Wenige Tage vor den zweiten Parlaments-, Präsidiums- und Kantonalwahlen setzen weder Vertreter ausländischer noch bosnischer Organisationen viel Hoffnung auf den Urnengang; gerechnet wird mit einer Bestätigung der ethno-nationalistischen Parteien.
Selbst ein Sprecher der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE), die die Wahlen organisiert und beobachtet, ist skeptisch: "Öfter wählen ist gut für die Demokratie", übt er sich gegenüber Jungle World in guter Laune, um dann gleich anzumerken, daß sich das Bollwerk der nationalistischen Parteien wohl frühestens beim übernachsten Wahlgang, "in sechs bis acht Jahren", durchbrechen lasse. Wenn Wahlen wirklich etwas ändern würden, würden sie sicherlich nicht von der OSZE durchgeführt. Gedämpfte Stimmung bei den Exporteuren westlicher Demokratie-Modelle auf dem Balkan.
Hatte der "Hohe Repräsentant" der internationalen Verwaltung in Bosnien, Carlos Westendorp, Ende letzten Jahres noch vollmundig 1998 als das "Jahr der Minderheiten-Rückkehr" angekündigt, wollen die meisten Politiker in den Kommunen und den Parlamenten Bosniens davon nichts mehr wissen. Nationalisten bestimmen weiterhin die politische Bühne: Blockiert wird die Rückkehr von Kroaten und Muslimen in die Republika Srpska ebenso wie die von Muslimen nach West-Mostar. Viele der bis Kriegsende mehrheitlich von Serben bewohnten Häuser in den Vororten von Sarajevo stehen leer.
Dabei hatte sich der auf Drängen der EU eingesetzte Spanier Westendorp seit seinem Amtsantritt letzten Sommer doch so bemüht, die staatlichen Institutionen des Landes zu einen - auch per Dekret, wie es der Dayton-Vertrag bei Unstimmigkeit zwischen den drei Mitgliedern des Staatspräsidiums vorsieht. Zuletzt im Frühjahr: Weil zwischen den größten bosnischen Parteien selbst über eine gemeinsame Fahne keine Verständigung herzustellen war, verordnete Westendorp den serbischen, kroatischen und muslimischen Nationalisten einheitliche Staatsinsignien.
Neben der Fahne und einer einheitlichen Währung, der "Konvertiblen Mark", haben inzwischen auch identische Kfz-Kennzeichen die alten Plaketten abgelöst. Nicht mehr erkennbar ist, ob ein Auto etwa aus der von kroatischen Nationalisten beherrschten Herzegowina oder der Serbischen Republik kommt - ein erster Schritt, um das in Dayton zugesicherte Recht auf Bewegungsfreiheit durchzusetzen.
Ein peinlicher Ausrutscher unterlief Westendorp jedoch bei der Einführung der verbindenden Reisedokumente. Die bislang weitreichendsten Eingriffe "des euro-spanischen Vizekönigs" (The Economist) in das institutionelle Gefüge Bosniens begannen im Chaos: Als die gemeinsamen Pässe gedruckt und zum Teil schon ausgehändigt waren, stellte man fest, daß die serbo-kroatischen Endungen falsch geschrieben worden waren - die Auflage mußte neu gedruckt werden.
Nicht zuletzt wegen solcher Fehler haben Nationalisten aller Seiten Westendorp schon als "Diktator", "regierenden General" und "Protektor" beschimpft. Mißgriffe wie auf der ersten Pressekonferenz nach seinem Amtsantritt, als er Bosnien in drei "Entitäten" unterteilte, sind Wasser auf die Mühlen derer, die weiterhin für einen Anschluß der serbischen Gebiete an Jugoslawien und der Herzegowina an Kroatien sind.
Die Amtsführung Westendorps, gepaart mit Ärger über die deutsche Abschiebepolitik, hat auch in den USA zu neuerlicher Distanz gegenüber der Bosnien-Politik der EU geführt. Bei einem Treffen mit bosnischen Offiziellen in der vergangenen Woche kündigte US-Außenministerin Madeleine Albright einen "aggressiven Zeitplan" zur rascheren Umsetzung der Dayton-Bestimmungen für die Zeit nach den Wahlen an. Alle US-Hilfsprogramme würden daraufhin überprüft, ob die Empfänger den Vertrag einhielten. Insbesondere die Verhinderung der Rückkehr von Bosniern in ihre Herkunftsorte werde zum sofortigen Stopp der Hilfszahlungen führen.
Einer darf natürlich nicht fehlen, wenn die USA Entschlossenheit auf dem Balkan demonstrieren: der vor dem Kriegsverbrechertribunal in Den Haag wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit angeklagte Radovan Karadzic. Vor drei Monaten wegen "destabilisierender Wirkung auf die Lage in Bosnien" vorübergehend abgeblasen, erklärte ein Albright-Berater gegenüber der Washington Post, daß die Suche nach dem Kriegsführer der bosnischen Serben erneut aufgenommen werde.
Doch eines, auch das machte Albright deutlich, hat sich gegenüber der bisherigen US-Bosnienpolitik geändert: Die Hauptverantwortlichen für eine weitere Spaltung sitzen nach Ansicht des State Department nicht mehr in der Serbischen Republik, sondern in Mostar. Washington hat den Schwarzen Peter an die kroatischen Hardliner weitergegeben. Die von Franjo Tudjman unterstützten bosnischen Kroaten, warnte der Albright-Berater, müßten sich möglicherweise auf die Wiederholung des Szenarios von Pale im Sommer 1997 einrichten: Wenn Tudjman den Einfluß seiner Sender auf bosnischem Territorium nicht beschneide, würden Nato-Kräfte "die Funktürme besetzen".
Die bosnische Serbenrepublik ist ihren Ruf als Paria Europas vorerst los. Mit der Verlegung des Regierungssitzes aus der Karadzic-Hochburg Pale nach Banja Luka haben sich die Institutionen Srpskas konsolidiert. Seit dem Amtsantritt von Präsidentin Biljana Plavsic und dem sozialdemokratischen Ministerpräsidenten Milorad Dodik sind die Verbündeten Karadzics auf Parlaments- und Regierungsebene weitgehend entmachtet. Und daß sich Plavsic von Karadzic getrennt hat, nicht aber vom Chauvinismus, der beide verbindet? Daß sie die Rückkehr von bosniakischen und kroatischen Flüchtlingen in die Srpska weiter hintertreibt? Was zählt, ist Plavsic' Bekenntnis zu Dayton - der bosnische Persilschein.
Als letzter Karadzic-Getreuer an der Macht bleibt Momcilo Krajisnik. Während sich Alija Izetbegovic und Ante Jelavic, kroatischer Vertreter im gesamtbosnischen Staatspräsidium, für die zügige Umsetzung der Vorgaben von Dayton gegenüber den ausländischen Sponsoren einsetzen - oder dies zumindest regelmäßig beteuern -, hat der serbische Repräsent Krajisnik bislang als einziger den Dayton-Schwur verweigert.
Aller Voraussicht nach wird der letzte Vertreter Pales bei den Wahlen am 12./13. September schlechter abschneiden als der Präsidentschaftskandidat Zivko Radisic, der das Plavsic-Dodik-Duo aus Banja Luka bald zum Trio erweitern könnte. Besondere Eignungen? Supporting Dayton, wie es so schön in den von der OSZE herausgegebenen Wahlempfehlungen heißt.

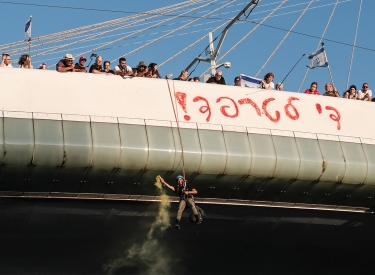
 Planlos in Doha
Planlos in Doha
