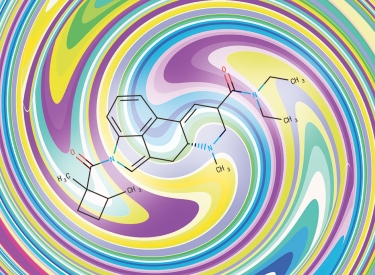Neue Uniformenvielfalt
Der Hochseefischer unterscheidet zwischen Zugnetzen, die er hinter seinem Kutter herschleppt und Treib-, Stell-, Sperr- und Schwebnetzen, die er, an einer Boje befestigt, abends auslegt und morgens wieder einholt. Er kennt pelagische Netze, feine Gespinste, die frei im Wasser flottieren, und das grobe Grundschleppnetz, das alles mitnimmt, was ihm in die Quere kommt. Für alle Netze aber gilt: Entscheidend ist die Maschenweite, und dicke Fische lassen sich besser fangen als kleine.
Für das "Sicherheitsnetz", das die Innenminister in der vergangenen Woche über die Republik warfen, gelten solche Beschränkungen nicht. Die Maschenweite ist von vornherein variabel; abgefischt werden sollen im Zuge der von Manfred Kanther initiierten Aktion vor allem die kleinen Fische. "Aggressives Betteln, Lärmen und Verunreinigungen" nennt ein am Montag vergangener Woche einstimmig gefaßter Beschluß der Innenministerkonferenz als Delikte, denen in Zukunft die besondere Aufmerksamkeit gelten soll - "differenziert und angemessen" selbstverständlich, schließlich gehört mehr als die Hälfte der Kanther-Kollegen der Sozialdemokratie an. Als "erfreuliches Ergebnis" begrüßte denn auch der rheinland-pfälzische Minister Walter Zuber (SPD), derzeit Vorsitzender der Innenministerkonferenz, den Beschluß. Er zeige "die Entschlossenheit von Bund und Ländern, die Innere Sicherheit gemeinsam zu stärken".
Gestärkt werden soll aber vor allem das Gefühl der Sicherheit. Flächendeckend sollen sogenannte Kommunale Präventionsräte eingeführt werden, "Sicherheitspartnerschaften" sollen für die Vernetzung von Polizei und örtlichen Behörden sorgen. Darüber hinaus sollen die Gemeinden auch selbst Personal bereitstellen, um auf den Straßen die Ware Sicherheit feilzubieten. Bürger, denen das nicht reicht, können außerdem sogenannte Sicherheitsinitiativen gründen - eine "sinnvolle Ergänzung", freuen sich die Minister. Bürgerwehren - das bedurfte der Betonung - lehnen sie aber ab. Eine "wirksame Ergänzung" seien dagegen private Sicherheitsunternehmen, deren Angehörige schon heute das Bild der Fußgängerzonen prägten. Damit ist der Uniformen-Vielfalt noch immer nicht genug: Ausdrücklich gelobt wird im Innenminister-Beschluß die Kanthersche Idee, künftig verstärkt die Bundespolizei Grenzschutz etwa im Umfeld von Bahnhöfen und in öffentlichen Verkehrsmitteln einzusetzen.
Damit so viele Polizisten und Hilfspolizisten auch ordentlich verhaften können, gehört die "Bereitstellung einer ausreichenden Zahl an Haftplätzen" zu den zentralen Programmpunkten der "Aktion Sicherheitsnetz". Und damit sich die Haftplätze rentieren, soll die Justiz "eine verstärkte Reflexion für ihren Platz im Sicherheitsgefüge" betreiben.
Für das Personal in den noch zu bauenden Gefängniszellen werden in Zukunft verstärkt auch Jugendliche sorgen: "Heranwachsende", so beschlossen die Innenminister, sollen grundsätzlich nicht mehr nach dem Jugendstrafrecht verurteilt werden, sondern nach dem allgemeinen. Für straffällig gewordene Kinder sollen wieder geschlossene Heime eingeführt werden.
Sehr neu ist das alles nicht. Das "Sicherheitsnetz" ist nicht mehr als der Versuch, das auf den Obrigkeitsstaat zentrierte deutsche Polizeikonzept um eine US-amerikanische Komponente zu erweitern. Von Barrow bis Punta Arenas sorgt eine wachsende bunte Truppe von Polizisten und Parapolizisten für das, was nach jeweils herrschender Meinung als Sicherheit gilt. "Präsenz zeigen", heißt dort das Credo aller Polizeiarbeit, dem gern ein - meist unausgesprochenes - "und Härte" hinzugefügt wird. New Yorks damaliger Polizeichef William Bratton hatte das Glück, unter dem Label "Zero Tolerance" diesen bürgerrechtlichen Rollback in seiner Stadt gerade zu einem Zeitpunkt durchsetzen zu dürfen, als ohnehin in den ganzen USA die Kriminalität zurückging.
Die Grundlage für Brattons Polizei-Philosophie bildete dessen "Broken-Windows"-Theorie: In einer "bad neighbourhood" hatte der Polizeichef zwei identische Autos abstellen lassen; bei einem davon ließ er die Scheiben einschlagen. Wenig später, berichtet Bratton, sei dieses Auto ganz demoliert gewesen, während das andere noch intakt war. Schlußfolgerung: Keinen Fußbreit der Unordnung, dann bleibt uns auch schlimmeres Unheil erspart. Bei einem Berlin-Besuch im vergangenen Sommer erklärte Bratton: Graffiti seien "die Flagge der Resignation"; "stoppen sie diesen Prozeß jetzt, solange es noch geht". Das war Wasser auf die Mühlen der Unionspolitiker, die bereits seit Anfang 1995 eine Daueroffensive gegen jugendliche Graffiti-Sprayer betreiben. Eine Sondereinheit der Polizei kümmert sich hier nur um die "Sprühdosen-Ferkeleien", wie Kanther es unnachahmlich formulierte.
Vor der praktischen Umsetzung der Kantherschen Ideen steht man in Baden-Württemberg. Zusätzlich zu den Freiwilligen Polizeihelfern, die hier uniformiert und bewaffnet auftreten, schickt die Landeshauptstadt Stuttgart kommunale Hilfspolizisten, sogenannte Gelbe Engel, auf die Straße. Jede Polizeidienststelle verfügt über einen eigenen Graffiti-Sachbearbeiter, der eine Graffiti-Kartei führt. Wird ein Täter ertappt, kommt ein Graffiti-Eingreifkommando zum Einsatz.
Das Modell der Freiwilligen Polizeihelfer hätte Kanther gern republikweit ausgedehnt. Bislang ist er damit an den SPD-Innenministern der Länder gescheitert. Dennoch konnten sich zahlreiche Genossen für die Kanther-Pläne erwärmen. Als der Bundesinnenminister wenige Wochen nach Brattons Deutschland-Besuch im vergangenen Sommer seine "Aktion Sicherheitsnetz" vorstellte, war unter den ersten Gratulanten Gerhard Glogowski (SPD), Innenminister in Niedersachsen. Angesichts der bevorstehenden Expo könne er sich vorstellen, sein Land in die von Kanther angesprochenen "mehrjährigen Feldversuche" einzubeziehen. Auch das rot-grüne Nordrhein-Westfalen drängte danach, an Kanthers Polizeistaat-Versuch teilzunehmen; wenn "den Worten auch D-Mark folgen".


 Ein brauner Geburtstag in Brandenburg
Ein brauner Geburtstag in Brandenburg