Staatskritik im Daddy Room
Bürokratie – das bedeutet Ineffizienz, Langsamkeit und endlos viele Formulare, so jedenfalls will es das Klischee. Die Ausstellung im Bürokratie-Museum in Berlin, das am 22. April eröffnet hat, bedient sich genau dieser Vorstellung und treibt seine Späße entsprechend. Kein Wunder: Die 350 Quadratmeter große Pop-up-Ausstellung wurde von der Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft (INSM) ins Leben gerufen, die im Frühjahr eine großangelegte Kampagne zum Bürokratieabbau begonnen hat. Das erste Kampagnenmotiv, ein Wappen der DDR mit Stempel und Heftklammerentferner anstelle von Hammer und Sichel, dazu der Slogan »Willkommen in der Deutschen Bürokratischen Republik«, waren selbst der FDP zu viel: »Unsäglich«, urteilte der FDP-Bundestagsabgeordnete Konrad Stockmeier.
Nun also ein Museum. Statt über die Geschichte oder die Vor- und Nachteile von bürokratischer Herrschaft zu informieren, wie man es von einer Ausstellung erwarten könnte, bemüht sich die Schau ausschließlich, Verwaltungsstrukturen lächerlich zu machen. Sie stellt Bürokratie als Sammelsurium von überflüssigen Regeln dar, mit denen das deutsche Beamtentum versucht, die Privatwirtschaft zu drangsalieren. Dass die Organisatoren des Museums sich primär um das Wohl von Unternehmen sorgen, ist nicht weiter überraschend. Bei der INSM handelt es sich schließlich um eine vom Arbeitgeberverband Gesamtmetall gegründete Lobby-Organisation.
Jeder, der schon einmal die Hotline eines Internetanbieters anrufen musste, um Probleme mit dem heimischen W-Lan-Router zu melden, wird bestätigen, dass sich die charakteristischen Ärgernisse der Bürokratie auch in der Privatwirtschaft finden lassen.
Am Eingang des Museums läuft man durch den Nachbau eines Mammutbaumstamms wie durch einen Tunnel. Einer Texttafel ist zu entnehmen, dass das Exponat jene 52 Bäume repräsentiere, die statistisch gesehen jeden Tag gefällt werden müssen, um allein den Papierbedarf der Bundesministerien zu decken. In der Rauminstallation »Daddy Staat«, die ein BDSM-Studio nachbildet, baumeln Handschellen, die wie Paragraphzeichen geformt sind, von der Decke. Daneben gibt es einen »Warte Warte Warte Warte Warte Raum« mit einem sitzenden Skelett, das den in Behörden endlos wartenden Bürger darstellen soll. Ein Terrarium mit Schnecken weist auf die Trägheit der deutschen Verwaltung hin.
Wut ablassen kann der Besucher beim Schreddern von Gesetzestexten, die als überflüssig erachtet werden. Zur Auswahl stehen beispielsweise die Kassenbonpflicht, das Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz und – kein Witz – das Lobbyregistergesetz. Das entstandene Konfetti (»Bürokrafetti«) darf in einer Tüte mit der Aufschrift »Bürokratie in ihrer schönsten Form« mit nach Hause genommen werden.
Die Intention ist klar: Der Verwaltungsapparat des deutschen Staats sei zu langsam und ineffizient und gefährde den Wirtschaftsstandort Deutschland.
Doch was meinen die Macher der Ausstellung eigentlich mit »Bürokratie«? Die Organisatoren definieren Bürokratie auf einer Informationstafel zu Beginn der Ausstellung als »Herrschaft der Verwaltung«. Man erfährt richtigerweise, dass sich der Begriff in dieser Form auf den physiokratischen Ökonomen Vincent de Gournay (1712–1759) zurückführen lässt, der das Wort »Bürokratie« scherzhaft aus dem französischen bureau (Schreibtisch) und dem griechischen krátos (Herrschaft) zusammengesetzt hat. Obwohl sich Bürokratie im Sinne dieser Definition keineswegs nur auf den Staat bezieht, ist genau das der alleinige Fokus des Museums. Dabei beobachtete bereits Max Weber, der ohne Zweifel die einflussreichste Theorie der Bürokratie entwickelt hat, dass sich bürokratische Strukturen nicht nur im Staat, sondern immer mehr auch in Unternehmen, Gewerkschaften, Parteien und Kirchen finden lassen. Jeder, der schon einmal die Hotline eines Internetanbieters anrufen musste, um Probleme mit dem heimischen W-Lan-Router zu melden, wird bestätigen, dass sich die charakteristischen Krankheiten der Bürokratie auch in der Privatwirtschaft finden lassen.
Ironischerweise ist genau das die zentrale Botschaft von David Graebers Buch »Bürokratie: Die Utopie der Regeln«, das dem Skelett im »Warte Warte Warte Warte Warte Raum« in die Hände gelegt wurde. Graeber kritisiert darin rechte Kritiker der Bürokratie, die behaupten, freie Märkte seien ein wirksames Gegenmodell zu den ineffizienten Strukturen der Bürokratie. Das Problem mit dieser Annahme sei, so Graeber, dass jene Unternehmen, die auf dem freien Markt erfolgreich sind, genau wie der moderne Staat immer mehr von den ineffizienten Regeln der Bürokratie durchsetzt sind. Deshalb gelte es, eine linke Kritik an der Bürokratie zu formulieren, die bürokratische Strukturen nicht nur im Staat, sondern auch gleichermaßen in Unternehmen angreift. Offenbar haben sich die Organisatoren des Bürokratie-Museums nicht die Mühe gemacht, das Buch, das sie den Besuchern anempfehlen, auch zu lesen. Sonst hätten sie bemerken müssen, dass Graeber alles andere als einer der Ihren ist.
Es ist also keineswegs so, dass eine konsequente Kritik der Bürokratie in einer Parteinahme für freie Märkte münden muss, wie die INSM dies propagiert. Ob die Bürokratie als Organisationsform generell verworfen werden sollte, ist eine weitere grundlegende Frage, zu der die Ausstellung kaum etwas Nennenswertes beizutragen hat. Zwar wird das Wort »Bürokratie« seit Gournay vorwiegend pejorativ verwendet, allerdings ist keineswegs klar, dass der Begriff per se eine abwertende Bedeutung besitzt. Max Weber hat Bürokratie auf weniger polemische Weise als System der Verwaltung definiert, in dem von ausgebildeten Fachkräften nach streng vorgegebenen Regeln Macht ausgeübt wird. Der Vorteil dieser Form von Herrschaft, so Weber, bestehe neben ihrer Effizienz darin, dass es individuellen Beamten nicht möglich sei, willkürliche Entscheidungen über das Leben anderer Menschen zu treffen.
Immerhin muss man zugestehen, dass einige der Vorzeigebeispiele der Bürokratie, wie das System der Beamtenprüfungen im kaiserlichen China, für lange Zeit sowohl effizient als auch einigermaßen meritokratisch funktioniert haben. Auch Lenin, der eigentlich keine Gelegenheit ausließ, um die Schattenseiten der Bürokratie zu kritisieren, sah im strikt regelgeleiteten Postwesen seiner Zeit einst das Vorbild einer rational geplanten Produktion.
Bis heute versuchen Soziologen zu klären, ob die optimistische Einschätzung des Potentials von Bürokratien haltbar ist. Tom Burns und G. M. Stalker argumentieren in ihrem organisationssoziologischen Klassiker »The Management of Innovation« beispielsweise, dass Bürokratien tatsächlich die von Weber genannten Vorteile aufweisen, wenn sie sich in einer Umgebung befinden, die sich nur langsam verändert. Es ist also keineswegs ausgemacht, dass Bürokratie lähmend auf eine Gesellschaft wirkt, wie die Organisatoren des Bürokratie-Museums weismachen wollen.
Wer eine ernsthafte Auseinandersetzung mit diesen Fragen sucht, kann sich einen Besuch im Bürokratie-Museum sparen.
Das Bürokratie-Museum, Georgenstraße 22, Berlin-Mitte, ist noch bis zum 25. Juni geöffnet.


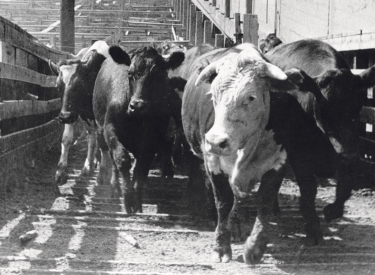
 Fortschritt in the Slaughterhouse
Fortschritt in the Slaughterhouse
