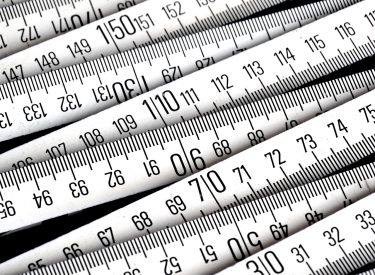Nicht wie immer
Weihnachten um die Feuertonne
Von Rebecca Wilbertz
In linken Kreisen wirkt es irgendwie anrüchig, an Weihnachten »nach Hause« zu fahren. Kein Wunder: Familie ist ein Laster wie das Rauchen. Langfristig ungesund, aber irgendwie klammert man sich weiter daran. In diesem Winter kommt die Empfehlung von Bundeskanzlerin Merkel, wegen der hohen Infektions- und auch Sterbezahlen in der Covid-19-Pandemie möglichst wenig Menschen zu treffen, zumindest denjenigen gelegen, die ein gutes Argument gegen die Fahrt zur Familie brauchen. Ist eigentlich das einzig Vernünftige, was man gerade machen kann – dort bleiben, wo man ist.
Um es gleich vorwegzunehmen: Ich bin eine von denen, die Weihnachten gern »nach Hause«, also zur Familie fährt, wenn auch nicht ohne Gruseln. Ich mag die Strukturierung des Jahresablaufs, den Lebkuchen und das Lametta. Es gibt einen feststehenden dramaturgischen Ablauf der Festtage, der wie Weihrauch gleichermaßen beruhigend und verstörend ist.
Die Hölle sind immer die anderen, da hilft auch der Verzicht auf’s Familientreffen nicht.
Dieser Ablauf beginnt, weil alle Sonderwünsche haben, bereits einige Tage vor dem offiziellen Festtermin mit dem Treffen der Tante, die die übrige Zeit mit ihrer Partnerin verplant. Es folgt ein Gelage mit dem zusammengewürfelten Haufen der erweiterten Familie mütterlicherseits: ein zynischer Cousin, ein Stiefvater und seine wirbeligen Schwestern, schweigsame Ehemänner, Kinder, aktuelle Affären und alle zehn Jahre ein neuer Hund. Dazu kommt eine sehr schnell sehr betrunkene Schwippschwägerin, die alle zum Tanzen auffordert, und der Nachbar, der irgendwann durch die Hecke geschlüpft ist. Gemeinsamer Nenner ist, dass alle nach viel Wein dürsten. Auf den Rausch folgt unweigerlich Ernüchterung und angespannte Gereiztheit. Von der wärmenden Glut des Glimmstängels ist nur noch kalter Rauch übrig. Aber was soll’s? Die Hölle sind immer die anderen, da hilft auch der Verzicht auf das Familientreffen nicht.
Nur dieses Jahr ist alles anders. Die Infektionszahlen gehen nicht runter, die Zahl der Toten steigt weiter. Das lässt an vielem zweifeln, auch an den Maßnahmen der Bundes- und der jeweiligen Länderregierung. Diese hatten ihre Kommunikationsstrategie für den »Lockdown light« auf dem Versprechen eines Weihnachtsfests im Schoße der Familie aufgebaut. Mit den eindrücklicher werdenden Appellen, auf alle »unnötigen Kontakte« zu verzichten, werden die politischen Ratschläge für den Einzelnen immer widersprüchlicher.
Aber was heißt das nun für die individuelle Entscheidung: Reisen oder nicht?
Bei der Abwägung scheint es vielleicht sinnvoll, den »pandemischen Imperativ« von Christian Drosten zur Grundlage zu machen: im Umgang mit anderen so zu handeln, als ob man selbst infiziert wäre und das Gegenüber schützen wolle, beziehungsweise als ob das Gegenüber infiziert wäre und man sich selbst schützen wolle. Aber müssten wir dann nicht alle in Quarantäne, wenn das die Prämisse wäre? Sich selbst und die anderen immer als potentiell gefährliche Virenschleudern zu betrachten, macht auch etwas mit Menschen. Vor der Pandemie konnte man die eigene Misanthropie noch meist unterdrücken, jetzt verzieht man mal schnell das Gesicht, wenn einen jemand aus Versehen auf der Straße streift – hinter der Maske glücklicherweise unbemerkt.
Der Reiseplan wird wegen der dramatischen Infektions- und Sterbezahlen immer wieder in Frage gestellt. Abwägen muss man zwischen irgendwie abstrakt bleibenden Infektionszahlen, die man potentiell noch erhöhen könnte, dem Wunsch, sich solidarisch zu verhalten, und den eigenen widerstreitenden Gefühlen. Bedenken und ein schlechtes Gewissen werden sich kaum abschütteln lassen. Im klitzekleinen Familienkreis um die Feuertonne zu stehen, den Zigarettenrauch auszuatmen und Kartoffelsalat zu essen, würde sich dagegen nach einem guten, fast normalen Moment anfühlen, so die Hoffnung.
Auch am Familienstreit wird das Coronavirus voraussichtlich seinen Anteil haben, schließlich gibt es in fast jeder guten Familie einen Schwurbler. Dass diese nicht nur vor dem Reichstagsgebäude rumstehen und das Internet vollschreiben, sondern sich auch in der eigenen Familie auslassen, macht den Umgang mit den eigenen Unsicherheiten in der Pandemie nicht einfacher. Allerdings erweitert es die Liste der Gründe, die fürs Hinfahren sprechen, um einen Bildungsauftrag für das Weihnachtsfest.
Weihnachten vor dem Fernseher
Von Veronika Kracher
Folgt man Wilhelm Reich, ist die Familie die Keimzelle des Faschismus. Die Erziehung in der bürgerlichen Gesellschaft ist bestimmt von Autoritarismus, Repression und patriarchalen Geschlechterbildern. Den Anspruch Adornos, in der Partnerperson und der Beziehung zu dieser einen Zweck an sich und nicht nur ein Mittel zur Befriedigung der eigenen Bedürfnisse zu sehen, erheben die wenigsten Menschen. Menschliche Nahbeziehungen bieten daher auch nur selten einen Ausblick auf die befreite Gesellschaft.
Auch wenn die bürgerliche Kleinfamilie in Auflösung begriffen scheint, wachsen die meisten Kinder immer noch primär in patriarchalen und heteronormativen DNA-Zwangskollektiven auf, in denen sie von klein auf kaum mehr sind als die Spielbälle der elterlichen Zwänge. Der Mythos des schützenden Schoßes, der mütterlichen Zuneigung und des trauten Heims als sicherem Ort, an den man sich nach einem zerrüttenden Tag in der kalten, kapitalistischen Grausamkeit zurückziehen kann, ist eben genau das: ein Mythos, der Frauen weiterhin an die Reproduktionssphäre bindet. Die Familie ist für die allermeisten Menschen kein Schutzraum vor der gesellschaftlichen Kälte, sondern deren Fortführung.
Nach dem dritten Glas Wein echauffiert sich irgendjemand darüber, dass die eigenen Familienmitglieder ohnehin nur undankbare Blutsauger seien, die das sich vom Munde abgesparte Weihnachtsessen nicht zu schätzen wüssten.
Jede Person, die schon einmal auf der Couch in einer psychoanalytischen Praxis lag, kann bestätigen: An den meisten Neurosen, die man in diesem beschädigten Leben angesammelt hat, haben die Eltern einen größeren Anteil. Diese wiederum haben von ihren eigenen Eltern so einiges mitbekommen, was kaum oder gar nicht reflektiert, geschweige denn überwunden an die Gören weitergegeben wird. Das einzig Vernünftige, was man da tun kann, ist die Flucht in eine ein paar Hundert Kilometer entfernte Stadt anzutreten und eine Psychoanalyse anzufangen, um die tiefsitzenden familienbedingten Traumata aufzuarbeiten. Alle sechs Monate kann man dann der Familie einen Höflichkeitsbesuch abstatten, meistens zu irgendeinem runden Geburtstag, auf jeden Fall aber an religiösen Feiertagen. Wie Weihnachten.
Weihnachten. Wenn die Sippschaft sich aufgrund religiöser Zurichtungen mit zusammengebissenen Zähnen um einen Tisch mit trockener Weihnachtsgans und labberigem Rotkohl sowie viel Alkohol schart und sich alle mal wieder vorgenommen haben, zumindest dieses Weihnachtsfest nicht zu einem Familienstreit ungeahnten Ausmaßes eskalieren zu lassen.
Meist ist das Weihnachtsessen stark ritualisiert. Vater schneidet – mühevoll, sie ist ja zu trocken – die Gans an. Alle loben das Essen, aus Angst, den erwarteten Familienstreit vom Zaun zu brechen. Dabei ist jede Person am Tisch der festen Überzeugung, ein besseres Festmahl zubereiten zu können, außer vielleicht der Teenager, der sich am liebsten von Fertigpizza ernährt. Anschließend gilt es, die Fragen der Eltern nach dem Ende des Studiums, der Arbeit und deren Sinnhaftigkeit nebst Verdienstmöglichkeiten und der (nicht vorhandenen) Familienplanung zu beantworten. Jede Antwort löst unweigerlich eine Zurechtweisung von einem der »erwachsenen« Familienmitglieder aus.
Nach dem dritten Glas Wein echauffiert sich dann irgendjemand über Geflüchtete, die »Homolobby«, »die da oben« oder darüber, dass die eigenen Familienmitglieder ohnehin nur undankbare Blutsauger seien, die das sich vom Munde abgesparte Weihnachtsessen nicht zu schätzen wüssten. Die Eskalation ist da und es bleibt, mal wieder, an der Mutter hängen, den Konflikt zu beschwichtigen.
Dieses Jahr gibt es jedoch die Möglichkeit, davon verschont zu bleiben. Die Covid-19-Pandemie hat viele Opfer verlangt, beschert aber am Jahresende zumindest einen kleinen Trost. Kaum jemand wird angesichts der steigenden Infektionszahlen guten Gewissens auf das Kitschritual Heiligabend bestehen wollen, schweren Herzens wird man sich zum Zoom-Call verabreden müssen und beteuern, wie sehr man einander vermisst. Und danach kann man sich aufs Sofa kuscheln, mit der queeren WG-Wahlfamilie »Gremlins« gucken und feststellen, dass man nie ein friedlicheres und entspannteres Weihnachten hatte als das diesjährige.