Die Kriegsmetapher in der Coronakrise
Regierungen in aller Welt haben einem unsichtbaren Feind den Krieg erklärt: Sars-CoV-2. Ein Krieg ist eine gewaltsame Auseinandersetzung zwischen verschiedenen Menschenkollektiven, ob nun Staaten oder irreguläre Gruppen. Insofern derzeit etwas anderes unter Krieg verstanden werden soll, handelt es sich um einen metaphorischen Krieg. Das Bild des Krieges soll hier zur Orientierung in einer neuen, beängstigenden Situation dienen. Die plötzliche Bedrohung erhält zumindest eine etwas klarere Kontur, wenn man einen bekannten Begriff für sie finden kann. Ob diese Wahl glücklich getroffen wurde, muss ein Blick auf die Schlachtfelder dieses eigenartigen Krieges zeigen.
Anfangs versuchten die Regierungen, den viralen Feind als Bedrohung aus der Fremde darzustellen und die Gefahr in ein vermeintliches Außen zu bannen. Als »China-Virus« (US-Präsident Donald Trump) wurde die Krankheit einer bestimmten Personengruppe oder einem bestimmten Territorium zugewiesen. Die Angriffe auf »asiatisch aussehende« Menschen folgen der ersten Zuschreibung, die Auszeichnung von Risikogebieten der zweiten.
Die Kriegsmetaphorik eignet sich gut zur weiteren Stärkung der Exekutive, in Ungarn und Slowenien kam es bereits zu rechten »Coronacoups«.
Als die Epidemie näherrückte, folgte eine Episode, die die feministische Philosophin Wendy Brown als »Spektakel der Mauer« bezeichnet: Der militärische Schutz der Landesgrenzen als symbolische Inszenierung staatlicher Souveränität und Kontrolle. Der starke Staat schützt die verletzliche Nation vor schädlichen Eindringlingen. Das Szenario ist seit längerem aus der Migrationsabwehr bekannt. Die Aufrüstung der Sprache geht mit der wirklichen Mobilisierung der Truppen einher. Ende April etwa gaben polnische Soldaten an der Grenze zu Tschechien Warnschüsse auf einen Fußgänger ab, um ihn am Grenzübertritt zu hindern.
Doch wie sinnvoll war die Zurschaustellung exekutiver Macht an den Außengrenzen? In Deutschland lagen seit Ende Januar Fälle von Covid-19-Erkrankungen vor. Aufgrund des hochinfektiösen Charakters der Krankheit war davon auszugehen, dass das Virus sich längst ungehindert von etwaige Maßnahmen an der Grenze im Territorium ausbreiten konnte. Doch durch die Ausweisung diverser Risikogebiete jenseits der Landesgrenzen demonstrierte man Wachsamkeit, trennte zunächst jedoch implizit zugleich das eigene Territorium von diesem Risiko ab.
Die Errichtung von Barrieren zwischen scheinbar sicheren und gefährlichen Zonen und Menschengruppen ist ein bekanntes kulturelles Schema im Umgang mit Ansteckung und Krankheit. So sprach der Spiegel von Aids anfänglich als »Schwulenpest«, die Medizin nannte das neue Phänomen zunächst »gay-related immune deficiency«. Solche Einordnungsversuche halten die Krankheit zwar in der Vorstellung auf Distanz, können zugleich aber zu ihrer wirklichen Ausbreitung beitragen. Im Fall von Covid-19 führte diese Praxis dazu, den Normalbetrieb in den scheinbar sicheren Zonen noch einige Wochen weiterlaufen zu lassen.
Irgendwann ließ sich das Virusproblem nicht mehr länger auslagern. Der Feind befand sich längst innerhalb der Mauern und die Frontverläufe verschoben sich ins Innere des Territoriums. Der Wehrbeauftragte des Bundestags, Hans-Peter Bartels, sprach vom »größten Einsatz im Innern in der Geschichte der Bundeswehr«, doch geht es dabei vor allem um unterstützende Maßnahmen durch Krankenhäuser, Sanitätseinheiten und Transportkapazitäten der Armee. Die regulären Truppen spielen eine Nebenrolle, andere Kombattantinnen rücken in den Vordergrund des Geschehens. Bundeskanzlerin Angela Merkel sagte in ihrer Fernsehansprache, das Krankenhauspersonal stehe »in diesem Kampf in der vordersten Linie«. Die Autorin Jagoda Marinic ergänzt: »Frauen sind wie die unsichtbare Armee, auf die sich Familien und der Staat verlassen.« Dieser metaphorische Krieg hat viele unkonventionelle Schauplätze.
Burgfrieden und die »Vergesslichkeit der Institutionen«
Es ist Krieg, das heißt auch: Es herrscht Burgfrieden. In der Coronakrise scheint es keine Parteien mehr zu geben. Lohnkonflikte und Auseinandersetzungen über die Arbeitsbedingungen sind wochenlang verschwunden, Kapital und Arbeit sitzen angeblich im selben schwarz-rot-goldenen Rettungsboot. In einer gemeinsamen Pressemitteilung verlautbarten der Vorsitzende des DGB, Reiner Hoffmann, und Arbeitgeberpräsident Ingo Kramer am 13. März: »Die Sozialpartner stellen gemeinsame Verantwortung in der Coronakrise über Differenzen. (…) Gewerkschaften und Arbeitgeberverbände haben sich in Krisenzeiten stets gemeinsam und verantwortungsvoll für das Gemeinwohl eingesetzt.«
Die Gewaltenteilung ist auf dem Rückzug, dafür ist die Polizei überall. In der »Tagesschau« wurde Mitte März beiläufig erwähnt, man suche nach Möglichkeiten, die Regierung auch ohne den Bundestag handlungsfähig zu halten. Die Kriegsmetaphorik eignet sich gut zur weiteren Stärkung der Exekutive. Autoritäre Kräfte wissen die Gelegenheit zur Machtausweitung zu nutzen, in Ungarn und Slowenien kam es zu rechten »Coronacoups«.
Die Maßnahmen sind nicht deshalb beunruhigend, weil sie einen schroffen Bruch mit dem Status quo darstellten. Sie sind beunruhigend, weil sie bestehende gesellschaftliche Entwicklungen verschärfen. Das 2019 neu verabschiedete sächsische Polizeigesetz stellt es etwa polizeilicher Willkür anheim, präventiv sogenannte Gefährder zu bestimmen, sie durch elektronische Fußfesseln an bestimmte Orte zu binden und mit Kontaktverboten zu belegen. Die Praxis der polizeilichen Ausweisung von »Gefahrengebieten« verbreitet sich seit den neunziger Jahren und kommt vor allem in migrantisch oder links geprägten Vierteln zur Anwendung, etwa auf der Leipziger Eisenbahnstraße oder im Hamburger Schanzenviertel. In diesen Gebieten kann die Polizei Grundrechte suspendieren und so einen »örtlich begrenzten Ausnahmezustand« (Olga Montseny) schaffen. Die Ausnahmen werden oft zur Regel.
Die Versicherung, die neuen Maßnahmen seien zeitlich begrenzt, ist wenig beruhigend, da sich die Pandemie leicht noch ein, zwei Jahre hinziehen kann und die Kriterien für eine Beendigung der Maßnahmen intransparent sind. Vor allem aber droht die »Vergesslichkeit der Institutionen«, vor der der Soziologe Wilhelm Heitmeyer im Deutschlandfunk warnt: »Wenn Macht mal ausgedehnt ist, geben solche Institutionen ihre Macht nicht freiwillig wieder her. Das ist die Erfahrung aus der Geschichte.«
Das Vertrauen in das Katastrophenmanagement des Staates ist groß, auch in der Linken. In der Jungen Welt rechnet Felix Bartels »die Sorge um die individuellen Freiheitsrechte« zu den »Spielarten des Asozialen« in der Pandemie, Kritik am bürgerlichen Staat führe zum »antikommunistischen Eifer«. Der Verzicht auf Bürgerrechte dient vermeintlich unmittelbar dem höheren Zweck des Überlebens, als dessen Treuhänder der Leviathan vermutet wird.
Dabei kommt kaum zu Bewusstsein, wie unangemessen die Kriegsmetaphorik im Zusammenhang mit dem erklärten Wunsch der Lebensrettung ist: Gerade im Krieg töten Staaten gezielt. Der Krieg ist die Fortsetzung der Politik mit anderen Mitteln, in ihm zwingt eine Partei ihrem Feind gewaltsam den eigenen Willen auf. Die Covid-19-Pandemie hingegen ist eine Gesundheits- und Fürsorgekrise, in der die Sorge um uns selbst und unsere Mitmenschen im Mittelpunkt stehen sollte.
Wie im Krieg gibt es auch in der Pandemie viele Tote zu beklagen. In Hotspots wie dem norditalienischen Bergamo starben zeitweise siebenmal so viele Menschen wie im Vergleichszeitraum vergangener Jahre. Militärlastwagen transportierten Leichen ins Krematorium, zivile Begräbnisrituale wurden ausgesetzt, Bilder von Massengräbern aus New York und anderen Städten gingen um die Welt.
Doch ist der Krieg als gewaltsam ausgetragener Interessenkonflikt von Kollektivsubjekten kein geeignetes Modell, um dieses Massensterben zu begreifen, das Virus ist kein Gegner, dem man gewaltsam seinen Willen aufzwingen kann. Anstatt das Geschehen mit schicksalhaften Metaphern zu überdecken, sind die vielfältigen sozialen Mechanismen zu analysieren, durch die der Kapitalismus zur Pandemie beigetragen hat. Vom Raubbau an der Natur, der in Form von Entwaldung und Agrarindustrie zur Übertragung von Viruskrankheiten von Tieren auf Menschen beiträgt, über den politischen Druck des Kapitals, um die Schließung von Ansteckungsorten (Schulen, Fabriken, Fußballstadien, Après-Ski-Clubs et cetera) zu verhindern, bis hin zum desolaten Zustand des Gesundheitssystems – überall schafft das System der Plusmacherei den fruchtbaren Nährboden für die Katastrophe.
Der diskrete Charme des Etatismus
Ein viel bemühtes Schlagwort im Zusammenhang mit Krieg und Heldentum ist die »Systemrelevanz«. Auf die ideologischen Implikationen dieser kybernetischen Ausdrucksweise hat Charlotte Wiedemann in der Taz hingewiesen. Die nüchtern daherkommende Redeweise von der Gesellschaft als »System« ist gerade in ihrer technischen Neutralität gefährlich. In dieser Vorstellung werden die einzelnen Arbeiterinnen als fungible Komponenten eines Apparats vorgestellt, die »den Laden am Laufen halten« und bei Ausfall ersetzt werden.
Wenn die soziale Maschine im Notstand ins Stocken gerät, kann der Staat jene Teile beschlagnahmen, die für das Funktionieren des Systems unentbehrlich sind. So stellte Spanien den privaten Gesundheitssektor unter staatliche Direktive, Trump wies General Motors dazu an, die Produktion auf Beatmungsgeräte umzustellen; dabei griff er auf ein Gesetz aus der Zeit des Korea-Kriegs zurück. Die Verwandtschaft solch dirigistischer Eingriffe mit der Kriegswirtschaft ist also nicht zu übersehen, auch wenn der Staat im lockdown nicht im Sinne einer allgemeinen Mobilmachung, sondern eher im Sinne einer Demobilisierung von Arbeitskräften eingriff, indem vor allem im Bereich der Dienstleistungen ganze Sektoren zwangsweise stillgelegt wurden.
Linke Kommentatoren wie Raul Zelik sehen in solchen Notmaßnahmen »etwas Utopisches«. Verstaatlichungen seien nicht länger als »sozialistisches Teufelszeug« tabuisiert, sondern stünden endlich auf der Tagesordnung. Auch ein Teil der Klimaschutzbewegung nutzt Krieg und Ausnahmezustand als positive Referenzmodelle für die Agitation, wenn er die Ausrufung des »Klimanotstands« fordert oder die vage geplante grüne Transformation der Wirtschaft mit den Anstrengungen der Kriegswirtschaft im Zweiten Weltkrieg vergleicht.
Solche Ideen stehen in einer fatalen Tradition, die der Rätekommunist Willy Huhn in seinen Studien zum »Etatismus der Sozialdemokratie« bis in die Anfänge der deutschen Arbeiterbewegung zurückverfolgt hat. In weiten Teilen der Bewegung waren die Vorstellungen sozialistischer Emanzipation bereits im Kaiserreich auf den Staat zentriert, den man als Statthalter vernünftiger Allgemeinheit in einer Welt des privaten Egoismus missverstand. Die Kriegswirtschaft ab 1914 gab diesen Sozialisten daher Anlass zur Freude, führte sie doch zur staatlichen Planung und Leitung des Wirtschaftslebens durch die Oberste Heeresleitung. An die Stelle der »Anarchie des Marktes« tritt die staatliche Organisation, durch die jede Arbeit unmittelbar zum Dienst an der Nation wird.
Heute wie damals nimmt die etatistische Linke keinen Anstoß daran, dass die Proletarisierten im sogenannten Kriegssozialismus nicht als Subjekte der Politik, sondern als Material zum Verschleiß vorkommen. Denn die staatlichen Eingriffe in die unternehmerische Freiheit erstrecken sich auch heute auf die menschliche Arbeitskraft, die notfalls als systemrelevante Komponente mit Zwang requiriert werden soll.
Ende März legte die nordrhein-westfälische Landesregierung einen Gesetzentwurf vor, der die Zugriffsrechte auf medizinisches Personal drastisch ausweitete. Nach der Vorlage sollen ausgebildete Ärzte, Pflege- und Rettungskräfte zukünftig zum Dienst verpflichtet werden können, auch wenn sie nicht in diesen Berufen arbeiten oder im Ruhestand sind. In Bayern kann die Katastrophenschutzbehörde sogar »von jeder Person die Erbringung von Dienst-, Sach- und Werkleistungen verlangen«, wenn es zur Abwehr einer Katastrophe, etwa einer Gesundheitskatastrophe, erforderlich ist. Diese Eingriffe in Arbeitsrecht und Berufsfreiheit stellen Schritte zu einer autoritären Transformation der Arbeitswelt dar.
Warnung vor dem Bürgerkrieg
Die Pandemie strukturiert das Zeitempfinden. Die Welt vor der Coronakrise scheint merkwürdig entrückt und beinahe irreal, was sowohl für die einst gewohnten Alltagsroutinen gilt als auch für das Weltgeschehen. Diese Wahrnehmung ist trügerisch, denn kein Ereignis ist derart disruptiv, dass eine historische tabula rasa entstünde.
Doch auch das entgegengesetzte Extrem lässt sich beobachten. Die israelische Psychoanalytikerin Merav Roth wies darauf hin, dass die menschliche Psyche in Krisensituationen zum Konservatismus neigt. Um das innere Schwanken zwischen Hoffnung und Verzweiflung, Angst und Zuversicht zu beruhigen, »blättern wir durch die Möglichkeiten in unserem inneren Fotoalbum und kleben klare Bilder aus der Vergangenheit an die Wand der Zukunft, die noch in Dunst gehüllt ist«. Dieser Mechanismus ermöglicht eine abgeklärte Prognostik, geht jedoch mit einem Verlust historischer Erfahrung einher. Für das Verständnis der historischen Situation ist die Einbeziehung längerer, kontinuierlicher Entwicklungstendenzen ebenso unerlässlich wie ein Sensorium für die irritierenden Momente des Neuen.
Die Weltwirtschaft befand sich bereits seit geraumer Zeit im Abschwung. Dieser Abschwung folgte auf einen Wiederaufschwung nach der Krise von 2007 bis 2009, der seinerseits der schwächste in der Geschichte des Kapitalismus war. Die Wirtschaft wuchs schleppend, Investitionen waren niedrig, die Schuldenlast von Staaten, Unternehmen und Privathaushalten dafür enorm. Während Löhne stagnierten und Arbeitsbedingungen schlechter wurden, griff die Austeritätspolitik soziale Sicherungssysteme und die öffentliche Daseinsvorsorge an, um Profite und Staatshaushalte zu sanieren. Die Klassengegensätze sind schroffer und kenntlicher geworden, von einer »nivellierten Mittelstandsgesellschaft« spricht kein Mensch mehr. Vielerorts entkleidet sich der Kapitalismus dabei seiner liberalen politischen Formen, weltweit formieren sich Varianten eines autoritären Kapitalismus. So ist etwa der Indikator für Pressefreiheit beziehungsweise ihre Einschränkung, den die Organisation »Reporter ohne Grenzen« errechnet, seit seiner Einführung im Jahr 2013 um zwölf Prozent gestiegen. 2019 war ein Jahr heftiger politischer und sozialer Kämpfe, ein Jahr der Massenproteste, Aufstände und des Sturzes von Regierungen, vor allem in der Karibik und Lateinamerika, Nordafrika und dem Nahen Osten.
Die italienische Basisgewerkschaft SI Cobas hielt ihre Mitglieder in der Logistik an, nur noch die Distribution von Lebensmitteln und medizinischen Gütern zu besorgen.
Seit dem Ausbruch der Pandemie machen Bilder leergefegter Metropolen die Runde, der Soziologe Hartmut Rosa begrüßte das Virus als »radikalste(n) Entschleuniger unserer Zeit«, Delphine in Venedigs Kanälen waren vielgeklickte Symbolbilder für Heilung und Versöhnung. Doch trotz der Ausgangssperren der Regierungen besteht enormes Konfliktpotential. Denn die Pandemie beseitigt keinen der Missstände, die die Massen jüngst auf die Straße trieben. Stattdessen verschlechtert sich ihre materielle Situation weiter. Wer noch Arbeit hat, muss sie unter gesundheitsgefährdenden Bedingungen verrichten. Wer seine Arbeit verliert, sieht der Verelendung entgegen.
Obwohl die Zentralbanken der westlichen Nationalökonomien mit beispiellosen Maßnahmen zunächst »die Verlaufskurve der Finanzpanik abflachten« (Adam Tooze), entwickeln sich die Lebensbedingungen der ungeheuren Mehrzahl global verheerend. Wie die »Freundinnen und Freunde der klassenlosen Gesellschaft« 2009 in ihren »Thesen zur Krise« festhielten, gibt es »keine Krise des Kapitals, die nicht zugleich eine Krise der Lohnarbeit wäre. ›Ihre‹ Krise ist immer ›unsere‹, weil ›sie‹ und ›wir‹ nicht auf verschiedenen Planeten leben, sondern Pole eines gesellschaftlichen Verhältnisses bilden.«
Die Internationale Arbeitsorganisation (ILO) geht davon aus, dass weltweit über 300 Millionen Vollzeitstellen im zweiten Quartal dieses Jahres gestrichen werden, etwa die Hälfte der Arbeitskräfte auf der Erde ist in ihrer Existenzgrundlage bedroht, wobei informell Beschäftigte besonders hart getroffen werden. Auch in den hochindustrialisierten Ländern leben viele von der Hand in den Mund und können nicht auf Ersparnisse zurückgreifen. In den USA haben zum 1. April nur noch 69 Prozent der Mieter ihre Miete gezahlt. Hinzu kommen empfindliche Störungen globaler Nahrungsversorungssysteme unter anderem durch Ausfuhrverbote und unterbrochene Lieferketten. Preissteigerungen und mangelndes Angebot könnten demnächst Hungersnöte »biblischen Ausmaßes« verursachen, warnt der Leiter des Welternährungsprogramms der UN.
Bürgerliche Kommentatoren befürchten, dass aus dem metaphorischen Krieg gegen das Virus schon bald reale Bürgerkriege hervorgehen könnten. Die Wirtschaftsnachrichtenagentur Bloomberg warnte: »Überall wo Covid-19 ankommt, verschärft es die ungleichen Bedingungen, die bereits vorher bestanden. Das wird in Kürze zu sozialen Unruhen führen, bis hin zu Aufständen und Revolutionen.« Wut und Bitterkeit wachsen und »schon bald können diese Leidenschaften sich in neue populistische oder radikale Bewegungen verwandeln mit dem Vorsatz, jedes ancien regime wegzufegen, das sie als ihren Feind begreifen«. Aus Sicht des Bürgertums drohen die irrationalen Leidenschaften der Massen die vernünftige Ordnung der Welt ins Chaos zu stürzen. Das Aufbegehren der Unterdrückten erscheint selbst als eine Art Naturkatastrophe. Die Übergänge zwischen der Bekämpfung unbotmäßiger Arbeiter und der von Naturkatastrophen waren auch historisch fließend, wie etwa die Geschichte der »Technischen Nothilfe« in der Weimarer Republik zeigt.
Tatsächlich übersetzten sich die schockartigen materiellen Verschlechterungen im Zuge der Covid-19-Pandemie sofort in Proteste und Kämpfe in aller Welt, die von neuen Blogs wie »Solidarisch gegen Corona« und »Fever Struggle« dokumentiert werden. In einigen Ländern wurden Supermärkte geplündert, in Städten wie New York laufen die größten Mietstreiks seit beinahe einem Jahrhundert an, es gründeten sich Netzwerke gegenseitiger Hilfe. Wilde Streiks und Arbeitsniederlegungen grassieren. Nach Beobachtungen von Kim Moody dominierten zunächst vor allem die Forderungen nach Gesundheitsschutz und Lohnfortzahlung im Krankheitsfall. Mittlerweile machen sich die finanziellen Engpässe der Unternehmer bemerkbar und es regt sich vermehrt Widerstand gegen Entlassungen und nichtbezahlte Löhne, etwa in zahlreichen italienischen Standorten des Paketzustellers TNT, bei Pizza Hut in London und in Textilfabriken in Bangladesh und Myanmar. Die Londoner Angry Workers schrieben, einige Lohnabhängige hätten in den Auseinandersetzungen der vergangenen Monate »begrenzte, aber reale Schritte in Richtung Arbeiterkontrolle gemacht«, indem sie die Entscheidungsgewalt darüber einforderten, ob, was, zu welchem Zweck unter welchen Bedingungen produziert wird. So erzwangen beispielsweise 5 000 Arbeiter bei Mercedes im spanischen Vitoria die Werkschließung durch Sitzblockaden, US-amerikanische Arbeiter bei General Electric forderten die Umstellung ihrer Produktion von Flugzeugmotoren auf Beatmungsgeräte, die italienische Basisgewerkschaft SI Cobas hielt ihre Mitglieder in der Logistik an, nur noch die Distribution von Lebensmitteln und medizinischen Gütern zu besorgen.
In Anbetracht dieser Ansätze proletarischer Selbstorganisation in der Krise diagnostizierte Ben Tarnoff im US-amerikanischen Commune Magazine, die Gegenwart lasse eine Revolution zumindest denkbar erscheinen. Die kollektiven Überlebensstrategien enthielten möglicherweise die Keime einer neuen Welt, da sie Schauplätze direkter Demokratie, gesellschaftlicher Macht und kollektiver Bedürfnisbefriedigung schaffen. Die wirkliche Bewegung, welche den jetzigen Zustand aufhebt, könne nur in den autonomen Aktionen der Proletarisierten und nicht in den Wahlkampagnen von beispielsweise Bernie Sanders ihren Ausgangspunkt finden.
Vorsicht vor allzu optimistischen Einschätzungen ist gleichwohl angeraten. Die Kämpfe der vergangenen zwei Monate blieben großteils defensiv, kurzlebig und, mit wenigen Ausnahmen wie der transnationalen Koordinierung von Amazon-Beschäftigten, lokal isoliert. Die Revolution mag denkbar werden, gedacht wird sie bislang kaum. Die Widersprüche der »alten Welt« vertiefen sich, aber die Konturen einer »neuen Welt« zeichnen sich derzeit ebenso wenig ab wie der Weg dorthin.
Statt einer positiven Aufhebung der Verhältnisse könnte auch eine gesellschaftliche Regression eintreten: verschärfte Konkurrenz im Hauen und Stechen um Marktanteile, »exklusive Solidarität« (Klaus Dörre) im Kampf um Arbeitsplätze und Wohlfahrtsleistungen. Werden die Regierungen die Krise meistern? Wird sich die Weltgesellschaft kannibalisieren? Oder werden sich sozialrevolutionäre Bewegungen formieren? Das sind praktische Fragen, auf die nur die wirklichen, lebendigen Menschen eine Antwort geben können.



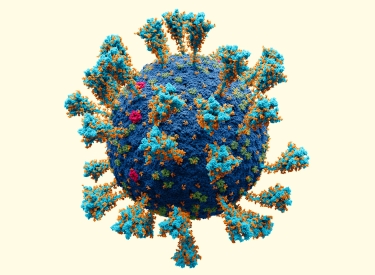
 Noch lange nicht zu Ende
Noch lange nicht zu Ende