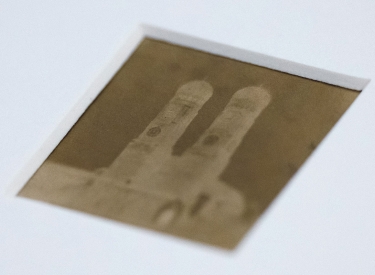Das Erzählen des Erzählens
Keine Lust zu ficken. Diesen Satz wird man in Frank Schulz' neuem Roman »Morbus fonticuli oder Die Sehnsucht des Laien« nicht finden; denn einerseits ist hier die Hauptfigur - ein Mann namens Bodo Morten, eine Art abgebrochener, aber, wie sich herausstellt, reichlich umtriebiger Journalist - ausgesprochen erpicht aufs Sexuelle, bezieht der Roman seinen auf 700 Seiten mühelos abgespulten Drive doch aus einer astreinen Fickgeschichten-Dramaturgie.
Andererseits und formidablerweise neigt Schulz bei der Beschreibung des Immergleichen zu ausufernder Vokabelvielfalt und schier enzyklopädischem Rundumgesang, wie er in der deutschen Literatur bis dato selbst in ihren verfeinert-verschweinerten Ecken noch nicht angetroffen wurde. Ob der Verlag deshalb gleich die Mitteilung, hier sei nach 100 Jahren endlich der neue »Buddenbrooks« zu vermelden, hätte lancieren sollen, mag offen bleiben. Erfreulicherweise hat das Werk, abgesehen davon, dass es in Norddeutschland angesiedelt und ziemlich dick ist, weder geistig-habituell noch literar-historisch noch nobelpreispolitisch irgend etwas mit der Thomas-Mann-Schwarte zu schaffen.
Möglich, dass der Haffmans Verlag mit dergleichen Renommisterei den drohenden Konkurs abzuwenden hoffte. Mal sehen, ob hier Hoffen hilft. Das Insolvenzverfahren ist Ende des letzten Jahres eröffnet worden. Schulz' Buch ist zunächst Teil zwei und Fortsetzung der vor zehn Jahren furios mit dem Roman »Kolks blonde Bräute« gestarteten »Hagener Trilogie«, wobei Hagen hier nicht am Arsch von Dortmund liegt, sondern südlich vom Hamburger Elbtunnel, der seinerseits bei Schulz als »Arschloch zur Welt« firmiert. Etliche aus dem »Kaff«, also Hagen, bereits bekannte Figuren des ersten Teils kehren in »Morbus fonticuli« wieder, um dort ihre Hauptbeschäftigung - Trinken, Rauchen, Sprücheklopfen - fortzusetzen.
Allen voran jener Bodo Morten, genannt Mufti, Ich-Erzähler, und zu Beginn des Romans erst einmal aus seiner Wohnung im Hamburger Süden verschwunden, weg, abgetaucht, wie er verblüffenderweise selber mitteilt, wie er auch das rat- und fassungslose Zurückbleiben von Frau und Freunden, ihre verzweifelt-komischen Versuche, sich über das Was-Warum-und-Wie klar zu werden, und ihre Nachforschungen, die bald höchst unerfreuliche Erkenntnisse zutage fördern, haarklein und seltsam eingeweiht schildert, wodurch der hübsche und paradoxe Effekt entsteht, als berichte hier ein allwissender Erzähler über das, was nach seinem Verschwinden vorgefallen ist.
Das ist eine ganze Menge. Dieser Morten ist zum Zeitpunkt seines Verschwindens ein 38jähriger, antidynamischer, arbeitsloser und zu Alkoholeskapaden neigender Durchschnittsversager, und muss, wie die Hinterbliebenen bald ermitteln, ein regelrechter Doppellebenskünstler mit Zweitwohnung, Konkubine und dubiosen Vermögenswerten gewesen oder aber immer noch sein. »Journale« genannte Tagebücher finden sich, aus denen Mortens Frau Anita zu ihrer nicht geringen Empörung sehr detaillierte Details über einen Pornographen, Sexmaniac und jederzeit geilen Bock erfährt, der es auf eine gewisse Bärbel über alle Maßen abgesehen hatte. Der Reiz dieser Trivialkonstruktion besteht in der sprachlichen - welches Wort nehmen wir? - Kunstleistung, mit der Schulz, der offenbar Nabokov, Schmidt und Henscheid auf Augenhöhe konsultiert hat, sämtliche Tonfälle zwischen deutscher Romantik, Wissenschaftssprech, Klotürpoesie und Dialektgerede ausbreitet.
Der Roman hat - das Feuilleton entlehnt hier gern das Wort Triptychon - drei Teile. Der erste, 100 Seiten lang, berichtet von Mortens Verschwinden und seinem Wiederauftauchen in einem Waldstück bei besagtem »Kaff«, der zweite enthält auf rund 600 Seiten die »Journale«, welche die Vorgeschichte des Dilemmas, Mortens Karriere bei einem südelbischen Käseblatt, diverse exquisite Alkexzesse nebst köstlich inspiriertem Suffgequatsche und vor allem die vermaledeite - sagen wir ruhig - amour fou bzw. hochtourige »Bärbelei« offenbaren, und der dritte schildert, wie sich Mortens Angelegenheiten nach Absolvierung zahlreicher höchstdramatischer Verknotungen entwickelt haben.
Die Erzählzeit umfasst ganze zehn Tage aus dem Leben des Protagonisten, vom 31. Mai bis zum 9. Juni 1995, in deren Verlauf allerdings, per Einschub, Rück- und Ausblick, zehn Jahre, die Zeit von 1987 bis 1996, zur Sprache kommen. Politisch relevante Begebenheiten wie etwa die deutsche Wiedervereinigung finden nicht statt. Wenn denn Politik auftaucht, dann nur als sonderbar ferne Parallelwelt, einmal in ein paar angeberhaften Briefen, die Morten von einem Freund aus El Salvador erhält, und einmal in der Klischeegestalt einer kommunistischen Redaktionskollegin, die sich um Häme nicht zu sorgen braucht. Die Welt, die Schulz offeriert, ist eine der Regression ins Private oder der Regression durchs Private, die jedoch mit der kundigsten, weitreichendsten und kuriosesten Introspektion einhergeht. Der Roman ist die Fortsetzung des grauen resp. grausamen Leib-Seele-Antagonismus mit komischen Mitteln.
Alleiniger Antrieb, ja, Trieb der Handlung und dramaturgisches Movens ist die animalische Geilheit, der Morten nach der ersten Begegnung mit jener zehn Jahre jüngeren, sexuell hemmungslosen, sonst eher ordinären Bärbel in einer Kneipe namens »Hexenkate« ausgeliefert ist: »Die Tür stand offen. Das Lokal war leer. Das heißt, am Ende des Tresens, da hockte dieses junge Weib, in diesem verwünschten Blümchenkleid, hockte da mit ihrem gottgegebenen Boulevardarsch auf einem Barhocker an der Stirnseite des Tresens, die gewaltigen Chaka-Khan-Schenkel übereinander geschlagen, so dass - in Keulenhöhe - satte achtunddreißig Zentimeter von der Scheitellinie bis zur Strumpfnaht vergingen. (Ich habe sie im Zuge eines unserer Körperspielchen später einmal ausgemessen.) Ihr weißes Kleid mit den rosa Rosen darauf, bis zur Hälfte des Oberschenkels gerutscht, leuchtete in der 40-Watt-Dämmerung. Die Brüste, obwohl schwebend wie Zeppelinbuge, wogen schon damals drei Pfund - jede.«
Schmuddel- und Schweinkram werden mehr als nur touchiert, Höhepunkt der pornösen Handlung und Zentrum des Romans ist ein Freiluftfick auf der Hamburger Köhlbrandbrücke, für den Schulz bloß zwei Sätze benötigt, die freilich in einen quasi kontrollierten, sich über vier Buchseiten erstreckenden Prosa-Amoklauf ausufern.
Doch wie vermutlich im realen Leben ist auch im Roman das Geficke nicht alles. Schulz' Werk liefert das Panorama einer postkleinbürgerlichen, keinem Engagement oder Ideal mehr aufsitzenden Welt, deren einzige Konstante der Soundtrack von Phil Collins und deren wahre Verkehrsform die untenrum zu sein scheint.
Bodo Mortens »Journale«, die sich diese Obszönität mit allen ihren Verheißungen und Verheerungen zu erschließen suchen, münden am Ende in den psychischen Totalkollaps, den der Protagonist zunächst in einem Erdloch, wo ihn die Freunde schließlich aufgreifen, und später in der Nervenklinik zu bewältigen hofft.
Dabei hat er die Krankheit, an der er zu leiden vermeint, selbst erfunden: Morbus fonticuli, die sich nicht schließende Fontanelle, die Mortens Hirn animalischen »Strahlungen« und sonstigen Störmanövern der Umgebung schutzlos preisgibt. »Wie das Luftbläschen im grünen Auge einer Wasserwaage bewegte sich träg, aber schon wieder geradezu greifbar plastisch ein Beiei in meinem Schädelballon. Nur in austariertem Zustand gab's keine Kollisionen mit den empfindlichen Ballonwänden.« Austariert allerdings war Mortens Zustand praktisch nie.
Die Sprachmächtigkeit aber, mit der Schulz die verschiedenen parallel laufenden Zeitebenen und Motivschleifen seines Textes austariert, macht auf höchst angenehme Weise sprachlos. Er ist gewissermaßen ein Erzähler vierter oder fünfter Ordnung. Manche Erzählungen in den »Journalen«, die noch etliche beachtliche Nebenstränge und -personen organisieren, sind Erzählungen von Erzählungen von Erzählungen, die wiederum weiter und nochmals erzählt werden.
So erzählt Morten, erzählt Schulz, etwa dem von ihm kreierten »SoMa« genannten »Sofamagazin«, dem er gelegentlich gönnerhaft Interviews gewährt, diverse Schweinkram-Episoden, die ihrerseits wieder aus-, ein-, durch- und ergreifender Kommentierung und Befußnotung bedürfen. So vertrackt es auch anmutet, so leicht liest es sich.
Frank Schulz hat - wie sagt man heute? - einen guten Job gemacht. Mit 750 Seiten, die noch ein Glossar enthalten, mag der Roman manchem zu dickleibig geraten sein. Wer ihn gelesen hat, wird ihn zu kurz finden. Und er wird sehr viel Platz haben im Bücherregal, aus dem die hoch- und oftbesprochene deutsche Gegenwartsliteratur der letzten 30 Jahre nun aussortiert werden kann.
Frank Schulz: Morbus fonticuli oder Die Sehnsucht des Laien. Haffmans Verlag, Zürich 2001, 765 Seiten, Euro 34,77

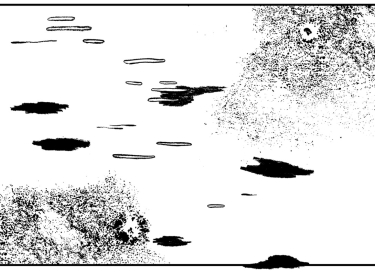
 »Birkenschwester«: Rückwärts zurück
»Birkenschwester«: Rückwärts zurück