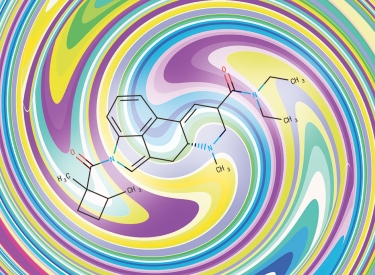Alles grün macht der Mai
Zumindest einer hätte zufrieden sein können: Hans-Olaf Henkel. Vielfalt statt Einheitsbrei hatte der Präsident des Bundesverbandes der Deutschen Industrie (BDI) gefordert und seine Kritik an den Klassengegner gerichtet. Genau genommen an die Vertreter der geplanten Vereinigten Dienstleistungsgewerkschaft ver.di, die den Zusammenschluss mit der entsprechenden Entwicklung in der Ökonomie begründen. »Nicht alle Megafusionen in der Wirtschaft klappen, und die erfolgreichen sind nicht die Gemischtwarenläden, sondern solche, die sich spezialisiert haben«, sagte Henkel.
Diesem Vergleich wollten sicherlich die wenigsten der 550 Delegierten der ÖTV folgen, die sich vergangene Woche im neuen Messezentrum Leipzigs trafen. Dennoch gelang ihnen ein Possenstück besonderer Güte, das Henkel zunächst Freude bereitet haben muss. Mehr als ein Drittel der Abgesandten des öffentlichen Dienstes votierte gegen ver.di, worauf der Vorsitzende Herbert Mai erklärte, nicht mehr für den Chefposten zur Verfügung zu stehen. Mit 78 Prozent beschlossen die Gewerkschafter nach dieser Ansage dann doch, im kommenden Frühjahr einen außerordentlichen Kongress in Berlin einzuberufen, um ver.di zu gründen. Das Happy-End kam in Gestalt des Personaldezernenten der Stadt Hannover: Frank Bsirske wurde mit 95 Prozent gewählt und tritt nun die Nachfolge Mais an.
Als die Delegierten des Gewerkschaftstages am vergangenen Donnerstag in diversen Zeitungen lesen mussten, sie seien eine Chaostruppe, wollte das natürlich niemand auf sich sitzen lassen. Da kam der Mann mit der gelben Blume im Knopfloch, der von Hannover nach Leipzig eilte, äußerst gelegen. Und er legte los: Wenn man unter links verstehe, der Gesellschaft ein solidarisches Antlitz zu verleihen, sei er ein Linker. Und wenn unter »modern« verstanden werde, sich für flexible Öffnungszeiten und Tarifverträge einzusetzen, sei er eben ein moderner Linker. Ohne große Personaldebatte wurde der ver.di-Befürworter Bsirske gewählt. Und gleich noch zwei neue Stellvertreter hinterher: eine mit SPD- und einer mit CDU-Parteibuch.
Zwei Tage lang verbrachten die Delegierten in der Diskussion um die geplante ver.di. Mindestens 70 Prozent Zustimmung wollte der bisherige ÖTV-Chef Mai. Für die Selbstauflösung der ÖTV im kommenden Frühjahr sind 80 Prozent notwendig. Vor dem Kongress hatte Mai angekündigt, den Gewerkschaftstag zu unterbrechen, wenn die notwendige Mehrheit nicht zustande komme. Nachdem sich nur 65 Prozent der Delegierten für ver.di aussprachen, folgten denn auch hektische nächtliche Beratungen. Dann trat der einstige Marathonläufer vor die Gewerkschafter und erklärte, ver.di sei nicht mehr möglich. Für ein Gewerkschaftsamt stehe er nicht mehr zur Verfügung.
Wem die gewerkschaftliche Rhetorik nicht ganz fremd ist, der wusste schon vorher, dass Mai sein persönliches Schicksal mit einer ausreichenden ver.di-Mehrheit verknüpfte. Dass er sich zumindest öffentlich nicht zu dieser Haltung bekannte, wurde ihm nach seinem Rückzug vorgeworfen. »Hätte ich offen mit Rücktritt gedroht, wäre mir das als Erpressungsversuch vorgehalten worden. Ich dachte, die Delegierten verstehen auch so meine Botschaft«, sagte Mai anschließend.
Keine Frage: Das Organisationsprinzip der Gewerkschaften ist nicht mehr zeitgemäß. Die deutschen Arbeitervertretungen orientierten sich nach 1945 am Industrie- und Branchenprinzip und am gut bezahlten männlichen Facharbeiter. Große Betriebseinheiten machten die Gewerkschaften damals stark, Angestellte und prekär Beschäftigte wurden lange Zeit nur am Rande wahrgenommen.
Nach den Umstrukturierungen zahlreicher Betriebe und ihrer Belegschaften ist der Organisationsgrad inzwischen von ehemals 35 Prozent auf nunmehr knapp 24 Prozent gefallen. Selbst Gewerkschaftsfunktionäre geben zu, dass der Abbau industrieller Arbeitsplätze als Erklärung hierfür nicht mehr ausreicht. Inzwischen diskutiert man darüber, ob Gewerkschaften als Kampforganisation oder als Serviceeinrichtung für Mitglieder eine Zukunft haben. Bisher ohne Ergebnis. Mit der Alternative »Gewerkschaften als Gegenmacht kontra Gestaltungsmacht« wurde eine künstliche Debatte eröffnet, während die gesellschaftspolitische Perspektive fehlt.
Erschwerend kommt hinzu, dass immer weniger Mitglieder bereit sind, sich in der Gewerkschaftsbürokratie aufzureiben. Hier hofft man auf Ansatzpunkte für den neuen Verband: ver.di soll dezentral aufgebaut werden und den Mitgliedern durch die Nähe zum Job eine organisatorische Plattform zu bieten. Aus eigener Betroffenheit könnten so Zukunftsperspektiven entwickelt werden. Das Ziel: Selbstorganisation anstatt Stellvertreterpolitik.
Doch viele altgediente Funktionäre befürchten, dass sich Interessen zu stark partikulieren. Es ist die Angst vor der Unübersichtlichkeit, die so manchen ver.di-Gegner umtreibt. Dabei wird natürlich vergessen, dass nicht die Mitglieder für die Funktionäre da sind, sondern die Funktionäre für die Mitglieder.
Doch solche Debatten wurden in Leipzig nicht geführt. Stattdessen dominierten Scheingefechte um Satzungsfragen und Geldzuteilungen. Den ver.di-Gegnern fehlt der Mut zur Vorläufigkeit. Alles muss bis ins Letzte geregelt sein.
Jetzt hat die ÖTV in Bsirske ihren Retter gefunden. Seine Wahl kommt einem Kulturbruch gleich: Er ist Mitglied der grünen Partei und steht dem Unternehmerflügel nahe. Das war nicht immer so. Zunächst Bildungsreferent bei der SPD-Jugendorganisation Falken, dann Mitarbeiter bei der grünen Kreisverwaltung in Hannover, übernahm er einen Posten beim ÖTV-Bezirk Niedersachsen. 1997 wechselte der Diplom-Politikwissenschaftler zu den Grünen und wurde für sie Personaldezernent in der niedersächsischen Landeshauptstadt - ein Wechsel, der für die Delegierten in Leipzig kein Thema war.
»Da wo es nötig ist, um die Leistungsfähigkeit zu erhalten«, bekennt sich Bsirske zum Stellenabbau im öffentlichen Dienst. Aus seiner Umgebung heißt es, er sei ein »moderner Verwaltungsmanager«. Was immer das sein mag, mit dem neuen ÖTV-Chef wird jedenfalls ein Vorgehen verbunden, das gemeinhin als »Mitarbeiter- und Bürgerpartizipation« umschrieben wird. Von solcher Partizipation, von Unternehmenskultur und Beteiligungsmodellen sprechen auch Vertreter des Kapitals. Die Vorlagen hierzu kommen aus der Industrie und von Gewerkschaftseinrichtungen. Nicht zuletzt ein Projekt der Bertelsmann-Stiftung, die 78,8 Prozent des Bertelsmann-Konzernkapitals hält, betrachten einige Gewerkschafter mit Argwohn: Mit der DGB-eigenen Hans Böckler-Stiftung bildet die Stiftung Betriebsräte zu »Managern des Wandels« aus.

 Ein brauner Geburtstag in Brandenburg
Ein brauner Geburtstag in Brandenburg