Töten für Einsteiger
Im Jahr 1923, so die Legende, stellte Felix Weil, millionenschwerer Unternehmersohn und Klassenflüchtling, dem akademischen Marxismus ein nagelneues Bürogebäude in die Frankfurter Senckenberganlage. Um die Stadtkämmerer nicht zu vergraulen, nannte sich die Forschungsstätte zur Antizipation der Revolution schlicht "Institut für Sozialforschung".
In Anlehnung an zentrale Einsichten der orthodoxen Psychoanalyse kritisierten Adorno & Co. die Übermächtigung des einzelnen durch die antagonistische Gesellschaft, die Identität nicht als Versöhnung, sondern nur als gewaltsame Anpassung kennt, unter anderem im Begriff der "Beschädigung". - So ungefähr hatte die Kritische Soziologie das Frankfurter Märchen bisher in Erinnerung. Nun hat freilich im Sog der Aufklärung jeder Mythos seine Halbwertzeit.
Der Freiburger Bioethiker Franz Josef Illhardt hat die Geschichte inzwischen gerade gerückt. Unter Berufung auf den Soziobiologen und Behindertenfeind Adorno suchte er anläßlich einer medizinethischen Fortbildungsveranstaltung, die Euthanasie aus der öffentlichen Schußlinie zu nehmen. Ein Recht auf Euthanasie, referierte er im Freiburger Zentrum für Ethik und Recht in der Medizin, würde "Leben am Ende und 'beschädigtes Leben' (Adorno)" nicht gefährden.
Leider hat Adorno wegen seiner Vorliebe für dialektische Schnörkel jene logisch-analytische Stringenz vermissen lassen, die heute in Form von operationalisierbaren Kriterien für den Behandlungsverzicht bei Wachkoma-Patienten und behinderten Neugeborenen von der Bioethik so lautstark eingefordert wird. Und nicht nur in diesen Fällen.
"Gerade im Umgang mit älteren Patienten", ergänzt Illhardt, "merkt man, wie wichtig es ist, ein unverkrampftes Verhältnis zum Problem der Sterbehilfe zu haben. 'Unverkrampft' soll in diesem Zusammenhang heißen, über das Problem nachdenken zu können, ohne phantasielos zu werden und in moralische Panik zu verfallen." Ganz entspannt über das Töten von Patienten diskutieren, die in der präfaschistischen Debatte noch "Ballastexistenzen" hießen - dies fordern deutsche Bioethiker mit einem neidvollen Blick auf die niederländische Praxis seit Jahren.
Daß in Zeiten knapper Kassenbudgets und teurer Therapie etwas mehr Phantasie im Umgang mit Problempatienten gefordert wird, wundert bei einer Philosophie nicht, für die "schwerlich vernünftig sein kann, was nicht denkbar ist" (Illhardt). Überraschender ist da vielleicht eher, daß z.B. Adornos Theorem von der "Liquidation des Ich" im Monopolkapitalismus nicht aufgeboten wird, um die radikale Räumung der Intensivstationen wenigstens einmal anzudenken.
Der Freiburger Lambertus-Verlag, der bereits Ende 1996 die Referate der Ethik-Tagung als Aufsatzband vorangekündigt hatte, wollte dieser Debatte dann doch kein Forum bieten. "Unsensibel und in Details nahe an Singers Gedankengut", lautete das verlagsinterne Urteil über einige Texte. "Wir wollten dem bioethischen Mainstream nicht die Pforten öffnen", sagte der damalige Lektor gegenüber der Jungle World.
Der Schattauer-Verlag im benachbarten Stuttgart dagegen hatte solcherlei Bedenken nicht. Es sei heute wichtig, verkündete die Lektorin Sylvia Wieland, bewußt Tabuthemen aufzugreifen. Vielleicht noch wichtiger könnte das finanzielle Engagement der Robert-Bosch-Stiftung gewesen sein, die schon die Tagung im Freiburger Ethikzentrum gesponsert hatte.
Der Titel des Bandes "Sterbehilfe - Handeln oder Unterlassen?" ist mit Bedacht gewählt. Die simple Alternative im Untertitel verweist auf das gewachsene Selbstbewußtsein der Euthanasie-Propagandisten, die gar nicht erst eine kontroverse Diskussion der Euthanasie-Idee vortäuschen, sondern nur noch die Frage verhandeln wollen, wann aktives Töten dem passiven Töten durch Unterlassung von Hilfe vorzuziehen sei. In der Praxis werden sich diese neuen "Behandlungsoptionen" durchsetzen können, wenn der Großteil der Bevölkerung sich erst einmal an die Vorstellung von einem schnellen, "schönen Tod" am Ende eines produktiven und aktiven Lebens gewöhnt hat.
So empfiehlt der Freiburger Arzt und Philosoph Martin Dornberg seinen Standeskollegen, schon heute die "Werte und Präferenzen der Patienten prospektiv zu erfragen", um sich gegen den Mordvorwurf abzusichern. Vor allem sollten die Bürger, fordert Dornberg, künftig verstärkt zur Abfassung von Patiententestamenten bewegt werden. Ob irgendwer für den so oft beschworenen "Extremfall" tatsächlich eine verantwortliche Entscheidung treffen kann, spielt dabei keine Rolle. Der rüstige Arbeitsmensch, der abends im Lehnstuhl seine Lebensqualität bilanziert, wird - darauf kann die Bioethik vertrauen - bei der Vorstellung eines Daseins jenseits von Sport, Leistung und Abenteuer schon jene Ekelgefühle entwickeln, die ihm eine lebenslange Behinderung in sinnloses Leiden übersetzen.
Ausführlich zu Wort kommt in dem Aufsatzband der deutsche Bioethiker Anton Leist, der in Zürich das Ethik-Zentrum der Universität leitet. Ähnlich wie sein Düsseldorfer Mitstreiter Dieter Birnbacher, der den modernen Arzt als "Helfer zum humanen Sterben" fordert, hat Leist es verstanden, während der öffentlichen Aufregung um Peter Singer dessen moralphilosophische Vorlage produktiv in die eigene Arbeit zu integrieren. In seinem Beitrag gelingt es Leist, die kühne Behauptung der Herausgeber, der "geistige Hintergrund der Tagung" unterscheide sich grundsätzlich von dem eines Peter Singer, eindrucksvoll zu widerlegen.
Zwar vermeidet Leist den Frontalangriff auf das Lebensrecht Behinderter, wie dies sein australischer Kollege vorgemacht hat. Im Hinblick darauf bemerkt Leist, sei zwar Singers Mut - und damit kann er nur dessen Brüskierung der Behinderten meinen - "sehr zu bewundern", doch diese Kühnheit ist eigentlich überflüssig. Denn mit der Frage nach dem Lebensrecht ist die nach dem Lebenswert noch lange nicht vom Tisch.
Gerade in der Behandlungsbegründung für Menschen, denen der reinen Lehre nach "der eigentliche Wertgegenstand der menschlichen Achtung" (Leist) fehlt, soll sich eine Position, die anstelle der utilitaristischen Kosten-Nutzen-Abwägung die individuelle Selbstbestimmung ins Zentrum stellt, auszeichnen. Darum sucht Leist im Rahmen seiner "Achtenslehre" auch pauschal für "Menschen, die nie in der Lage waren, selbständig zu denken", bewegliche Kriterien zu entwickeln, von deren Erfüllung das Weiterleben dieser Menschen abhängen soll. An die Stelle der (vermuteten) selbstbestimmten Entscheidung tritt bei Wachkoma-Patienten, Demenzkranken und Neugeborenen "ein breiter gefaßter Begriff der menschlichen Fähigkeiten".
Dieses angeblich so fürsorgliche Potentialitätsprinzip hat allerdings seine Grenzen. Von dieser Potentialität will Leist nämlich nichts mehr wissen, "wenn bei Menschen die Fähigkeit definitiv verloren oder ihre Entwicklung definitiv ausgeschlossen ist. Vielleicht sind manchmal auch die schlechten Bilder eines Malers wertvoll, nur weil sie von ihm stammen, aber wieweit das eine rationale Haltung ist, sei dahingestellt; sicher sind sie nicht auf dieselbe Weise wertvoll." Formprinzipien, wie sie in der traditionellen Kunst gelten, lassen sich eben auch auf das Gesamtkunstwerk "Mensch" übertragen, und welcher Museumsdirektor respektive Eugeniker will sich schon durch die Belobigung eines auffallend schlecht geratenen Werks blamieren?
Somit handhabt Leist Singers Diskriminierungskonstrukt der "Person" nur etwas großzügiger. Während Singer Selbstbewußtsein und Kommunikationsfähigkeit zu den Mindeststandards des Menschseins erklärt, will Leist bei "geistig geschädigten Menschen" mehr als das, nämlich "vielfältige Fähigkeiten" bewundern. Damit nicht die Illusion entsteht, nun könne jeder Behinderte nach seiner Fa ç on glücklich werden, stellt Leist sogleich klar: "Auch noch dieses stark erweiterte Fähigkeitenprinzip wird allerdings eine Klasse von Menschen unerfaßt lassen, die tatsächlich nur noch zu Empfindungen in der Lage sind."
Menschen, die dem Ideal "echten" Menschseins in der liberalen Konkurrenzgesellschaft nicht entsprechen, sind für diese Philosophie ein weißer Fleck. Das Verdikt muß daher so lauten: "Das menschliche Leben (ist) nur darin 'menschlich', daß es typisch menschliche Fähigkeiten entwickelt. Ein Leben, das permanent und unkorrigierbar auf diese Fähigkeiten verzichten muß, ist nicht mehr wert, gelebt zu werden."
Weil Leist natürlich weiß, daß seine praktischen Vorschläge auch auf den zweiten Blick nicht von denen eines Singer oder Hoerster zu unterscheiden sind, erteilt er seinen Mitstreitern eine Generalabsolution: "Da Philosophen wie Singer und Hoerster", warnt er seine Kritiker, "zu ihren Urteilen aufgrund von intellektueller Redlichkeit gelangen, ist es unangebracht, (...) ihnen (...) vehemente moralische Vorwürfe entgegen (zu)halten."
Wenn intellektuelle Redlichkeit zu unmoralischen Urteilen führt, die gegen moralische Vorwürfe abgedichtet sind, dann allerdings ist die Konfusion perfekt und die positivistischen Prämissen verschwinden im dichten Ethiknebel. Sicher, man könnte daraufhin wieder Frankfurter Mythen mobilisieren, wonach die analytische Philosophie die aus der Totalität sorgfältig herauspräparierten Erkenntnisobjekte stets ihrem vorgefaßten Begriffssystem subsumiert und ihnen damit in der Theorie jene Gewalt antut, die in der Praxis folgen wird.
Doch heute, wo der Ideologieverdacht unmodern ist und die NS-Geschichte in der neuen Geschwätzigkeit verklappt wird, steht die praktische Philosophie der Bioethiker, die noch für die schwierigsten Lebensfragen flotte Tips mit normativer Kraft bereit hält, höher im Kurs als eine radikalisierte Aufklärung, die in der Differenz zur NS-Euthanasie die Kontinuitäten erkennt.
Franz Josef Illhardt/Hermann Wolfgang Heiss/Martin Dornberg (Hg.): Sterbehilfe - Handeln oder Unterlassen? Schattauer, Stuttgart/New York 1998, 156 S.


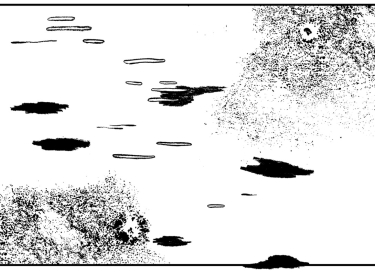
 »Birkenschwester«: Rückwärts zurück
»Birkenschwester«: Rückwärts zurück