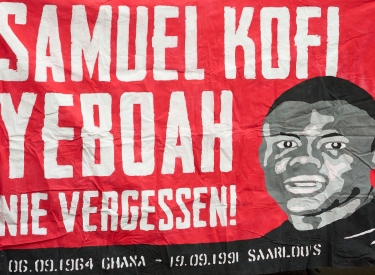Sonderstab Musik
Die jüdische Cembalistin Wanda Landowska floh aus Paris, als die Nazis einmarschierten. Nach dem Krieg war ihre Sammlung kostbarer historischer Instrumente verschwunden, ebenso die Musikbibliothek mit 10 000 Bänden und MusikerInnenautographen. Die Plünderung war das Werk einer eigens für solche Aktionen gegründeten Institution des NS-Staats: Des "Amtes Musik" beim Einsatzstab Reichsleiter Rosenberg der NSDAP, kurz auch "Sonderstab Musik" genannt.
In seinem jüngst erschienenen Buch "Sonderstab Musik - die organisierte Plünderung jüdischen Eigentums in der NS-Zeit" beleuchtet der niederländische Musikwissenschaftler Willem de Vries die Aktivitäten dieses Sonderstabs. Gegründet wurde er 1940 vom NS-Chefideologen Alfred Rosenberg. Zu seinen Aufgaben gehörten Konfiszierungen in den besetzten Ländern Belgien, Frankreich und Niederlande, vor allem von jüdischem Eigentum.
Zur Beute aus den Plünderungen gehörten wie bei Wanda Landowska vor allem Musikinstrumente und Kompositionen, die bei Tausenden jüdischer KomponistInnen, MusikerInnen, Verlage und Musikbibliotheken beschlagnahmt wurden. Neben der physischen Vernichtung der Jüdinnen und Juden Europas sollte die Plünderung von Musikalien, bildender Kunst und Malerei jegliche Form jüdischer Identität vernichten. Die Musikalien wurden "arisiert", also sogenannten arischen Deutschen zur Verwendung überlassen. Bis heute wurde nichts davon den eigentlichen EigentümerInnen zurückgegeben.
Als de Vries sein Buch Ende November in der Universitätsstadt Göttingen vorstellte, verursachte er einen Eklat. Denn bei seinen Recherchen war er immer wieder auf den Namen eines Göttinger Musikwissenschaftlers gestoßen: Prof. Dr. Wolfgang Boetticher. Bis 1944 war der SS-Mann Boetticher maßgeblicher Mitarbeiter im Sonderstab Musik gewesen. Unter anderem wirkte er an dem 1940 herausgegebenen "Lexikon der Juden in der Musik" mit, das sämtliche im Musikbereich tätigen Juden und Jüdinnen erfaßte und ab 1940 systematische und gezielte Plünderungen bei ihnen ermöglichte.
Nach 1945 habilitierte sich Boetticher an der Universität Göttingen, er wurde Dozent am Musikwissenschaftlichen Institut. In den siebziger Jahren war er Dekan der Philosophischen Fakultät, wo der 84jährige bis heute Lehrveranstaltungen hält. Boetticher wurde zu einer Göttinger Persönlichkeit; auch die Volkshochschule feierte jüngst sein hundertstes Veranstaltungsangebot.
Dabei war Boettichers Geschichte auch der Universitätsleitung kein Geheimnis: Nach Aussagen eines Mitarbeiters des Musikwissenschaftlichen Seminars war die NS-Vergangenheit des Professors bereits seit den fünfziger Jahren allgemein bekannt - sowohl an der Universität wie im Göttinger Bildungsbürgertum.
Mit den Vorwürfen aus de Vries' Buch konfrontiert, rechtfertigte sich Boetticher in einem Memorandum und erklärte, er habe dem Sonderstab nie angehört. Er sei diesem nur "als Wehrmachtsangehöriger und dienstpflichtiger Soldat mit unterem Mannschaftsgrad zugeteilt" gewesen, "um als Zivilist Quellenstudien zur älteren Musikgeschichte auch in den besetzten Gebieten betreiben zu dürfen". Ob Boetticher nun "Gast" des Sonderstabs war, wie er selbst behauptet, oder Leiter: Die Verbrechen des Amtes Musik erwähnt er in seinem Memorandum noch nicht einmal - geschweige denn, daß er sie bedauern würde.
Die Universitätsleitung beruft sich heute darauf, die Vorwürfe gegen Boetticher seien neu und ihr bisher nicht bekannt gewesen. Doch bereits 1982 sind in der New York Times und der Frankfurter Rundschau Artikel erschienen, die Boettichers Vergangenheit beleuchteten. Seitdem konnte Boetticher sich auf keinem internationalen Symposium mehr blicken lassen. Nur in der BRD blieben die Konsequenzen bis heute aus. Die deutsche Musikwissenschaft hat noch nicht einmal angefangen, ihre Rolle im Nationalsozialismus aufzuarbeiten; die Monographie des Niederländers de Vries wurde im deutschsprachigen Raum sofort zum Standardwerk.
Doch auch nach dem Erscheinen des Buches hält sich die Universitätsleitung bedeckt: Zwar wurde Boetticher nahegelegt, seine Veranstaltungen bis zur Klärung der Lage einzustellen. In einer offiziellen Stellungnahme beruft sich die Uni-Leitung aber darauf, "daß eine Mitwirkung Boettichers an Verbrechen der bezeichneten Art sowohl straf- als auch disziplinarrechtlich verjährt" sei. Außerdem seien "die Indizien, die auf eine Schuld Boettichers im Zusammenhang mit Kunstraubzügen des Amtes Rosenberg hinweisen, aufgrund der historischen Distanz nicht mehr verifizierbar". Anrufe beim Bundesarchiv in Koblenz oder beim jüdischen Dokumentationszentrum in Paris (Centre de documentation juive contemporaine) hätten freilich genügt, um rund ein Dutzend Dokumente anzufordern, die Boettichers Beteiligung am Sonderstab Musik bestätigen.
Die Universitätsleitung scheut das Thema Nationalsozialismus aus gutem Grunde; fehlt es doch auch in vielen anderen Fachbereichen an Aufarbeitung. Boetticher ist kein schwarzes Schaf, sondern ein Wissenschaftler unter vielen, die ihre Karriere, trotz ihrer NS-Vergangenheit, nach 1945 fortsetzen konnten - bis heute. Der Jura-Professor Ludwig Schreiber, der sich, kurz bevor er sein Amt als Universitätspräsident aufgab, mit dem Fall Boetticher beschäftigte, kam zu dem Schluß: "Wenn wir mit der NS-Zeit aufzuräumen begännen, könnten wir die gesamte Universität schließen."



 Mit gelöster Bremse
Mit gelöster Bremse