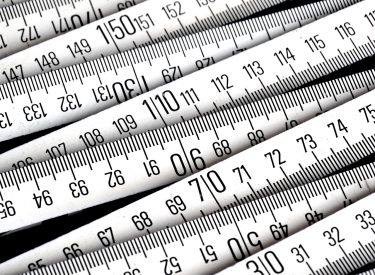Gute Unterhaltung!
Skandale sind für den Popbetrieb unverzichtbar. Aber was ist ein bedeutsamer Skandal, und was erfolgt aus einer kühlen Berechnung? Und ist es überhaupt sinnvoll, die Frage in dieser Form zu stellen? Die Beiträge im Titelthema »Pop und Provokation« (Jungle World, Nr. 14/06) tun dies jedenfalls, und sie tun dies in der Annahme, Pop müsse politisch sein, bevor er überhaupt Pop sein dürfe. Dies entspricht der gängigen poplinken Sicht, die Politik und Pop wechselseitig in die Pflicht nimmt und stets zur selben Schlussfolgerung gelangt: Provokationen, die harmlos sind, weil sie nichts bewirken, sind nicht nur unpolitisch, sondern auch kein Pop. Doch selbst eine harmlose Provokation ist immer noch eine Provokation, und vielleicht ist Pop gerade durch diese Harmlosigkeit, die allenfalls der Hochkultur Konkurrenz machen will, gut beschrieben.
Die buchstäblich durchsichtige Inszenierung, wie der Auftritt von Sarah Connor im transparenten Kleidchen bei »Wetten, dass …?«, ist eben auch eine Provokation. Sie mag politisch belanglos und hochgradig lächerlich sein, dennoch wird über sie tagelang berichtet. Und daran allein lässt sich das Gelingen einer Provokation ermessen. Sie muss nicht Stoff für eine politische Debatte hergeben, es genügt, wenn sie zahlreiche Reaktionen in der Öffentlichkeit hervorruft.
Das Beispiel ist banal und hat nicht jene Brisanz, für die in der deutschen poplinken Diskussion Namen wie Mia, Fler, Rammstein oder Bushido stehen. Aber auch Banalitäten, sofern sie unterhaltsam sind, zeichnen den Pop aus. Das ist nicht immer schön, und im Fall der ehemaligen Schönheitskönigin aus Delmenhorst aus einer poplinken Sicht auch nicht ohne weiteres nachvollziehbar. Aber dass Provokationen an erster Stelle gut unterhalten können, zeigt sich ausgerechnet dort, wo Pop vergeblich auf den politischen Begriff gebracht werden soll.
Das Streitgespräch zwischen Bushido und einem Mitglied der Gruppe Kanak Attak in der Süddeutschen Zeitung vom Sommer vergangen Jahres ist dafür ein gutes Beispiel. Es verdeutlicht, wie verloren politische Einwände gegenüber der Schlagfertigkeit eines Pop-Provokateurs sind, der alles andere sein will, nur nicht politisch: »Ich würde nie politischen Rap machen. Die Leute können sagen, du klingst rassistisch, nationalistisch, sexistisch, kriminell, damit kann ich leben. Aber wenn sie sagen würden: Du machst politischen Rap – oh mein Gott!« Dieses Gespräch zeigt außerdem, wie wenig Politik von Pop versteht, wenn sie dessen Vorbildfunktion anmahnt und darauf verweist, dass der Pop seine Wirkungen nicht kontrollieren könne. (»Du verlierst in dem Moment die Definitionsmacht über den Inhalt und die Intention deiner Songs, in dem sie veröffentlicht werden«, sagt Murat Güngör von Kanak Attak. »Willst du Musiker für alles verantwortlich machen? Ob ich davon beeinflusst werde in meinem Denken, kann ich selbst entscheiden«, antwortet Bushido.)
Nicht nur, dass niemand von sich behaupten kann, die Definitionsmacht darüber zu behalten, was er oder sie für andere geschrieben, gesagt, gesungen oder sonst wie produziert hat. Wer so auf dem politischen Einfluss von Pop insistiert, redet nicht nur über die Köpfe derer hinweg, die ihn konsumieren, und darüber, wie sie ihn konsumieren. Das eigentliche Interessante an Pop, an Kunst allgemein, das Vermögen nämlich, fiktionale Realitäten zu erzeugen, in denen es auch asozial zugehen darf, wird damit unmöglich gemacht.
Politisch korrekte Aussagen bleiben dadurch korrekt. Aber was hat das mit Pop zu tun? Wenn Pop etwa gesellschaftliche Vorstellungen von Sexualität und Körperleitbilder liefert oder neoliberale Leistungsanforderungen transportiert, ist seine enge Beziehung zum Politischen offenkundig. Und die Vermutung, dass nicht »Reden an die Nation«, sondern populäre Massenmedien wie Musik, Film und Fernsehen die maßgebliche Arbeit an der Herstellung kollektiver Selbst- und Fremdbilder verrichten, wird ebenfalls überzeugen. Aber egal, welches Thema vom Pop aufgegriffen wird und dann möglicherweise zur Verhandlungssache von Bedeutungskämpfen wird – es sagt nur etwas darüber aus, womit Pop sich beschäftigt, aber nichts über den Pop selbst.
Wenn man dies nicht unterscheidet, kann man zwar dennoch über den sinnvollen Einsatz politisch provozierender Botschaften reden, aber warum müssen diese durch Pop verbreitet werden? Und warum schränkt es Qualitäten des Pop ein, wenn ihm an politischen Botschaften überhaupt nichts gelegen ist? Gewiss ist die Popkultur, wie Jörg Sundermeier (Jungle World, 14/06) schreibt, »vorab affirmiert« und ist »Verpflichtung geworden«, aber verpflichtet auf was? Wenn Pop unentwegt provozieren, irgendwas Neues bieten muss, um auf sich aufmerksam machen zu können, ihm aber nicht mehr einfällt als der Sound, der schon mal gehört, oder die wackelnde Kamera, durch die schon mal gesehen wurde, wird er langweilig und wird bald vergessen. Pop funktioniert wie ein Kochtopf: schnell heiß, schnell kalt. Wen interessiert noch, was aus Mia geworden ist? Und auch der Weg des Kriegers Bushido ist irgendwann zu Ende, wenn dem Rapper seine Mittel ausgegangen sein werden, sein Vokabular noch aggressiver zu machen.
Um angesichts all dessen, was schon einmal da war, überhaupt aufzufallen, muss Pop sich stets übertreffen. Deswegen wird die Wortwahl gewalttätiger, unangenehmer, krasser; deswegen sind die Spielregeln bei »Big Brother« von Container zu Container ungemütlicher; deswegen müssen Special Effects immer spezieller werden.
Eine Diskussion über Pop schadet nicht der Diskussion, aber immer dem Pop, wenn die Diskussion bezwecken soll, den Pop zu politisieren. Wo er wachrütteln, die »bürgerliche Gesellschaft« stören soll, wird er langweilig oder führt dazu, dass diejenigen, die dafür einstehen, von den Erwartungen bisweilen vollkommen überfordert werden, beides zu erfüllen, gleichermaßen Pop und Politik zu sein. Nicht was Pop sagt, zeigt, hörbar macht, sondern wie er dies unter Einsatz welcher Mittel tut, entscheidet darüber, ob er gut und schlecht gemacht, interessant oder langweilig ist.
Wenn dabei mit Pop auch ein guter Schnitt zu machen ist, mag das den Genuss an ihm erheblich einschränken. Die Kritik, dass in der Popwelt Provokationen zur faden Verkaufsmasche werden, stört sich daran, dass eine fremde, weil ökonomische Logik die des Pop überlagert und ihn ausbeutet. Könnten die, die Pop machen, es nicht als ebenso störend empfinden, dass sich Popintellektuelle über »ihren« Pop mit Coolness und demonstrativer Distanz zum akademischen Betrieb mitzuteilen wissen, die ihre eigene smarte Rede trotzdem noch in Hörweite zu biederer Wissenschaftlichkeit halten, um auch dort noch verstanden zu werden? Wer liest die ganzen Texte über Pop? Die, die Pop machen, oder die, die Pop konsumieren?
Man kann annehmen, wie die bisherigen Beiträge der Diskussionsreihe es tun, dass die Popcodes nicht mehr funktionieren, weil jede noch so gute Provokation durch das gute Wirtschaften mit ihr überhaupt nicht mehr auffällt. Es wäre dann nur konsequent, den Pop von seinen Verwertungen zu trennen – und zwar nicht nur von seiner wirtschaftlichen Einträglichkeit, sondern auch von der politischen und publizistischen Diskussion über ihn. Das geschieht jedoch nicht, weil die These vom Zusammenbruch des Pop politisch formuliert wird. Dann heißt es: Die Provokationen wirken nicht mehr, weil sie politisch blass und bedeutungslos geworden sind. Pop darf nur Pop sein, wenn das politische Manöver stimmt.
Politische Aussagen sind unweigerlich normativ. Pop dagegen will gefallen, allgemein zugänglich sein und niemanden ausschließen. Wenn er gut ist, besitzt er unleugbare Reize, die auch das notorisch schlechte Gewissen versöhnen, das sich einstellt, wenn man Gefallen an einem politisch reaktionären, aber gut gemachten Film gefunden hat. Pop informiert nur darüber, wie hier die politisch reaktionäre Aussage des Films in Szene gesetzt wird.
Wo beides vermengt wird, wird es autoritär. Es ist dann eine Sache, Pop unter Ausschluss von allem, was als Pop trotzdem noch funktioniert, politisch zu definieren. Eine andere Sache ist es hingegen, wenn man dadurch den Diskurs für staatliche Eingriffsversuche und öffentliche Meinungsmache interessant macht. Diese können zwar auch nichts gegen Pop ausrichten, aber nicht selten bestimmen sie die Tonlage des Redens über Pop. Eine poplinke Sicht sollte darauf achten, sich davon noch zu unterscheiden. Politisch sinnvoller könnte es daher sein, die Grenze von Politik und Pop zu verteidigen und anzuerkennen, dass Pop zunächst nichts anderes sein will als gute Unterhaltung.
Über Pop dann noch politisch zu diskutieren, ist mehr als wünschenswert und macht die politische Bewertung von Pop vielleicht erst attraktiv. Sicher ist aber zumindest eines: dass die Diskussion über das Politische im Pop dann überhaupt noch stattfinden kann und nicht aus Enttäuschung über zu große Erwartungen an Pop abgebrochen wird.