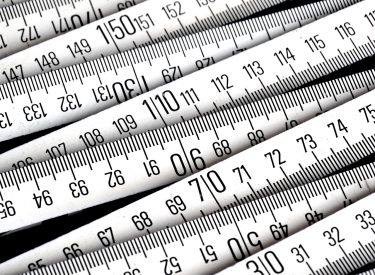Linkspartei statt Einheitsbrei!
Die meisten der 54 Abgeordneten sind nicht neu im Geschäft, und das merkt man. Die Linksfraktion macht einigermaßen zügig die Dinge, die man nur machen kann, wenn man im Bundestag sitzt. Beim öffentlichen Gelöbnis der Bundeswehr versuchte sie, DemonstrantInnen Einlass zu verschaffen. In Sachen Irak-Krieg übt sie Druck auf Grüne und SPD aus, einen Untersuchungsausschuss einzusetzen. Sie hat sich als einzige Fraktion mit den streikenden Hafenarbeitern solidarisiert. Sie bemüht sich, den Kontakt zu den außerparlamentarischen Bewegungen zu verbessern.
Pragmatisch gesehen, besetzen 54 Abgeordnete der Linkspartei 54 Sitze, welche die Allparteienkoalition des Neoliberalismus nicht hat. Es ist eine Menge Geld, das von Linken statt von Rechten ausgegeben wird – für Menschen, für Material, fürs Herumfahren und Telefonieren, fürs Denken und Schreiben. Es gibt eine Menge Rechte, die die Linke ohne die Fraktion nicht hätte – Anfragen stellen, im Parlament reden, Informationen bekommen, im Fernsehen auftreten, dabei sein. Die politische Stiftung der Partei bekommt mehr Geld, und ein Linker in der Provinz kann sich gegenüber dem Verfassungsschutz und juristischen Ausgrenzungsversuchen besser zur Wehr setzen. Die Linke ist materiell stärker geworden.
Ob 120 Tage Linksfraktion im Bundestag etwas gebracht haben, ist zweifelhaft, wenn man die Frage politisch-strategisch stellt: Was bringt es für die Sache der Revolution? Klar ist, dass der Schritt in den Bundestag ein Schritt näher an die Macht ist. Viele befürchten, man werde sich dem politischen Gegner und dem herrschenden System über kurz oder lang anpassen.
Ganz ohne Assimilation geht es nicht. Alle gesellschaftlichen Umbrüche mit progressiver Tendenz sind das Ergebnis einer Annäherung zwischen den linken Kräften und den größeren Teilen der Bevölkerung, ihren Klassen, ihrer Sprache, ihren Erfahrungen. Das galt für den Zapatismus, das galt für die populären kommunistischen Parteien Südeuropas und Lateinamerikas. Umbrüche sind auch das Ergebnis einer Assimilation von linken Kräften und dem gesellschaftlichen System, in dem sich beide verändern. Alle Menschen leben in einem bestimmten System, und sie können kein neues von der Stange kaufen, sondern müssen es Kräften und Prozessen anvertrauen, die es ändern und die sich darin auch auskennen. Zum Beispiel der Linksfraktion.
Eine populäre Linkspartei muss auch hineinwachsen in den politischen Apparat. Gleichzeitig muss sie an ihrer Differenz zu diesem Apparat arbeiten, nicht nur kulturell, sondern in ihrer konkreten politischen Vision. Sie muss die drängenden Probleme benennen, die niemand sonst zu benennen wagt. Sie muss Antworten geben, die aus Kapital- und Klientelinteressen nicht mehr gegeben werden dürfen. Sie muss strategische Projekte in Angriff nehmen, die nicht mehr die neoliberale Gleichung ausfüllen, sondern verändern.
Genau an diesem Punkt ist die Bilanz unzureichend. Die Fraktion hatte dieses Feld einmal berührt, bevor es sie gab, und sich gleich wieder, sich in politischer Correctness übend, aus ihm zurückgezogen. Und zwar nach Lafontaines »Fremdarbeiter«-Rede. Die enthielt alle wesentlichen Fragen: Was tun wir eigentlich gegen den globalisierten Dumping-Wettbewerb? Was heißt »gleicher Lohn für gleiche Arbeit« heute noch, angesichts unterschiedlicher nationaler Reproduktionsniveaus? Welche Instrumente brauchen wir, um gesellschaftliche Verhältnisse zu gestalten und nicht nur Marktergebnisse zu exekutieren?
Der »Fremdarbeiter«-Begriff gehört zum Vokabular der Rechten, das ist zu Recht festgestellt worden. Was aber sagen wir zu den Problemen, um die es ging? Müssen Mindestlöhne und eine Grundsicherung her, oder verändern wir die Grundlagen der Situation? Machen wir Keynesianismus für die ganze Welt, oder schotten wir uns ab? Diese Fragen sind nicht beantwortet worden, weder von der Fraktion noch von der Linken generell.
Die Existenz einer Linksfraktion im Bundestag ist Ausdruck der Tatsache, dass die Linke auch hierzulande wieder angefangen hat, sich der Machtfrage zu stellen. Dafür muss sie aber auch an den Antworten arbeiten, in welche Richtung es denn gehen soll, und mit welchen Instrumenten und Kräften. Wenn sie sich dem nicht stellt, dann wird auch die Fraktion wieder verschwinden – oder ihre frustrierten Reste werden zu einer Variante des sozialdemokratischen Neoliberalismus überlaufen.