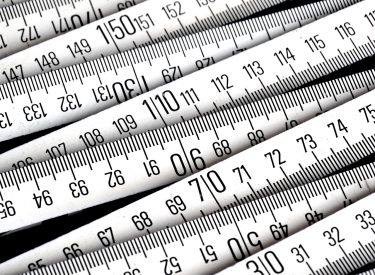Über den Tisch gezogen
Das gerade beendete Weltsozialforum (WSF) in Porto Alegre hat eine Vorgängerkonferenz, die dem Forum und den Diskussionen mancher Globalisierungskritiker näher steht, als es viele gerne zugeben: die UN-Konferenz für Umwelt und Entwicklung von 1992 in Rio de Janeiro.
Auf den ersten Blick mag dieser Eindruck täuschen. Während sich in Porto Alegre die Vertreter sozialer Bewegungen trafen, versammelten sich in Rio die Repräsentanten von Regierungen und zahlreichen NGO. Aber das in Rio verabschiedete Dokument Agenda 21 prägt bis heute mit dem zentralen Begriff der »Nachhaltigkeit« die globalisierungskritische Diskussion. Auch für den Umstand, dass ausgerechnet staatliche Institutionen zu Trägern der Veränderung und Umverteilung avancierten, ist dieses Dokument mitverantwortlich.
Während die Agenda diese Ziele klar benennt, sind sie bei den Globalisierungskritikern nicht immer direkt erkennbar. Die vielfältigen Appelle an staatliche Stellen mit der Bitte um eine keynesianische Umverteilungspolitik, wie sie bei Attac beliebt sind, sind jedoch keine Zufälle.
Seit der UN-Konferenz für Umwelt und Entwicklung von Rio haben sich, von vielen Linken unbeachtet, bis in die letzten Winkel der Republik Diskussionszirkel zur Agenda 21 gebildet. Für zahlreiche Umweltgruppen und Dritte-Welt-Organisationen gilt die Agenda als Leitfaden für eine ökologische und soziale Entwicklung im neuen Jahrhundert.
Verfasst wurde das Dokument im Wesentlichen von den Regierungen der wirtschaftlich führenden Staaten, der USA und Deutschlands. Im Zusammenhang mit dem dem zweiten Golfkrieg, der von der USA propagierten Neuen Weltordnung und dem von der Bundesrepublik betriebenen Einsatz der Bundeswehr zur Sicherung »unserer Rohstoffe« war die Agenda 21 ein Befriedungsangebot für die Vertreter der Zivilgesellschaft, um die Auswirkungen der Globalisierung abzufedern.
Während die internationale Politik immer häufiger mit offener Gewalt verbunden ist, geht es in der Agenda um freundliche Diskussionsrunden, in denen alle das Gleiche wollen. Eine Vorstellung, die auch auf der Nachfolgekonferenz in Johannesburg im vergangenem September gepflegt wurde.
Die große Resonanz ist umso erstaunlicher, wenn man sich näher mit dem Inhalt des Dokuments beschäftigt. So wird im Kapitel 22 beispielsweise die uneingeschränkte Nutzung der Atomenergie befürwortet und ein »sicherer und umweltverträglicher Umgang mit radioaktiven Abfällen« für möglich gehalten. Ähnliche Aussagen werden dort auch über die Nutzung der Gentechnologie getroffen.
Unverblümt wird in den nachfolgenden Kapiteln von der Überlegenheit des europäischen Entwicklungsmodells gegenüber den Gesellschaften in der so genannten Dritten Welt gesprochen. Die Fähigkeit indigener Gesellschaften »zur uneingeschränkten Mitwirkung an einem auf eine nachhaltige Entwicklung ausgerichteten Umgang mit ihrem Land« habe sich wegen historischer, ökonomischer und sozialer Faktoren »als begrenzt erwiesen«, heißt es im Kapitel 26.
Beim Lesen fühlt man sich in die Anfangszeit der entwicklungspolitischen Diskussion zurückversetzt. Die Industriestaaten zeigen den unfähigen Gesellschaften im Süden den (ökologisch) richtigen Weg und richten ihn auf die Bedürfnisse der reichen Länder aus. Eine kolonialistisch gefärbte Haltung, die längst überwunden schien, erlebt mit der Agenda eine neue Auflage. Das Dokument affimiert den vorherrschenden technologischen Entwicklungsweg und die bestehenden Macht- und Herrschaftsverhältnisse. Das europäische Entwicklungsmodell soll ein Vorbild für alle sein, lautet das Credo der Agenda.
Nach der Konferenz wurde die Abschlusserklärung sowohl von der internationalen Presse wie auch von den meisten renommierten Umweltorganisationen heftig kritisiert. Vor allem die Tatsache, dass die Regierungen der führenden Industriestaaten an der Formulierung beteiligt waren, weckte damals große Skepsis. »Die Bundesregierung spricht von einem Erfolg. Internationale Umweltverbände wie Greenpeace oder die Freunde der Erde aber beklagen, dass eine historische Chance verpasst worden sei, dass die Politik sich auf globaler Ebene dem Druck mächtiger Wirtschaftsinteressen gebeugt habe«, kommentierte damals die Frankfurter Rundschau.
Bereits wenige Jahre später änderte sich diese Wahrnehmung. Insbesondere die Grünen begannen, sich positiv auf das Dokument zu beziehen, mit etwas zeitlichem Abstand folgte die SPD. Und auch der Bund Umwelt und Naturschutz (Bund) vergaß seine anfängliche schroffe Kritik und entdeckte nur noch Gutes.
Gleichzeitig verlor die Umweltbewegung die Fähigkeit, die Öffentlichkeit für ihre Themen zu interessieren und Vorstellungen jenseits der Realpolitik zu formulieren. Ihre Politik institutionalisierte sich, während die sozialen Bewegungen an Bedeutung verloren. In den Kommunen wie auf Landesebene wurden nun »runde Tische« installiert und die enge Kooperation mit Parteien und Organisationen wurde angestrebt.
Wer nach weiteren Gründen für die positive Resonanz der Agenda sucht, sollte die zahlreichen Personalstellen und Haushaltsposten, die im Rahmen der Agenda-Prozesse geschaffen wurden, nicht vernachlässigen. Die Botschaft war nur allzu deutlich. Wer mitmacht, bekommt etwas vom Kuchen.
Wer heute eine öffentliche Förderung für ein Projekt beantragen will, kommt nicht umhin, Begriffe wie »Nachhaltigkeit« oder »Bürgerbeteiligung« zu verwenden. Und wenn es mal nicht zum Geldsegen reicht, dann gibt es zumindest öffentliche Anerkennung im medialen Diskurs der Zivilgesellschaft. Gemäß der Agenda reicht es aus, sich mit Industrievertretern an einen runden Tisch zu setzen und mit Argumenten zu überzeugen.
Dabei weiß jeder Gewerkschafter, dass sich kein Unternehmer durch gute Worte beeindrucken lässt, sondern nur von der Bereitschaft, notfalls auch zu streiken. Ebenso wenig wird es einen realen oder gar »nachhaltigen« Ausstieg aus der Atomenergie geben, der durch bloßes Zureden oder im Konsens erfolgt.
Und auch der häufige Verweis von Befürwortern der Agenda, es komme nicht darauf an, was in dem Dokument stehe, sondern was daraus gemacht werde, ist nicht sehr schlüssig. Wer sich in einem lokalen Arbeitskreis engagiert, kann sicherlich an sinnvollen Projekten beteiligt sein. Doch gleichzeitig wirbt man damit auch für eine Agenda, die auf einem affirmativen Verhältnis zur bestehenden Herrschaft beruht, und übernimmt deren analytische Kategorien von Staat, Ökonomie und (Zivil-) Gesellschaft.
Die Agenda 21 ist ein aktuelles Beispiel dafür, wie moderne Herrschaft im 21. Jahrhundert funktioniert. Die von den Regierungsapparaten formulierten politischen Inhalte und Begriffe werden von den NGO aufgenommen und anschließend mit Unterschriftensammlungen, runden Tischen und Appellen populär gemacht. Mit einer grundlegenden ökologischen oder gar sozialen Umorientierung hat die Agenda so viel zu tun wie die Nato mit einer friedlichen Politik. Sie ist eine mit viel Geld finanzierte Konsensmaschinerie, die mit dem Anschein von Bürgerbeteiligung soziale Proteste integriert und damit zur Modernisierung des bestehenden Verteilungsmodells von gesellschaftlichem Reichtum beiträgt. Ein Hamsterrad für (Nicht-) Regierungsorganisationen.
Die Agenda 21 hat die aktuellen Diskussionen zur Globalisierung stark beeinflusst und mit ihrer Ideologie des Konsenses und Mitmachens bei gleichzeitigem Erhalt des Bestehenden vielen Globalisierungskritikern näher, als es häufig wahrgenommen wird. Es sollte nicht vergessen werden, dass die Ideologie der Agenda 21 auch zur politischen Sozialisation vieler der heute aktiven Globalisierungsgegner beigetragen hat.
Die Aktivisten in den Agenda-Arbeitskreisen wirken zwar im Vergleich zu Globalisierungskritikern in ihrer Wortwahl und in ihrem Auftreten meist etwas bieder. Doch auch wenn in diesen Kreisen keine Fahnen geschwenkt werden, gibt es doch viele Gemeinsamkeiten.
Während die Agenda 21 den ökonomischen Status quo beibehalten will, nur eben ökologisch und sozial abgefedert, möchten viele Globalisierungsgegner zu einer keynesianistischen Verteilungspolitik zurück. Beide blenden Herrschaftsverhältnisse aus und sehen die USA als Hindernis gegen eine mögliche Weltordnung des »Guten«. Mit utopischem Denken im Sinne einer sozialen Umgestaltung hat das so viel zu tun wie das Programm einer beliebigen Bundestagspartei oder das Konsenspapier, das der Deutsche Gewerkschaftsbund und Attac entworfen haben.
Dass die Delegierten auf dem Attac-Kongress Anfang Januar dieses Papier zwar ablehnten, gleichzeitig aber den einmal vereinbarten Konsens nicht mehr zurückweisen wollten, ist eine beeindruckende geistige Leistung und zeugt vom selbst produzierten Anpassungsdruck. Im Vergleich dazu erscheint in gewisser Weise sogar die Agenda 21 noch sympathisch. Ein nachhaltiges »Weitermachen wie bisher« wird darin wenigstens ohne den verbalradikalen Gestus vieler Globalisierungsgegner propagiert, die doch nur das Gleiche wollen.
Der Autor ist Mitarbeiter der Aktion 3. Welt Saar (a3wsaar@t-online.de), die auch im Bundeskoordination Internationalismus (Buko) mitarbeitet.