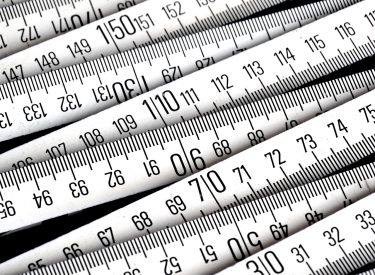Alle gegen die EU?
In kaum einem europäischen Land trifft die EU auf so starke Ablehnung wie in Dänemark. Das Spektrum der Anti-EU-Bewegung reicht dabei von linken Parteien wie der Enhedslisten bis zu rechtsradikalen Gruppierungen. Ist es überhaupt möglich, eine Anti-EU-Politik zu betreiben, ohne gleichzeitig nationalistische Positionen zu übernehmen?
Kurt Lund ist Mitglied der Europa-Kommission der Enhedslisten und Redakteur der Wochenzeitung Notat, die von den vier größten Anti-EU-Gruppen politisch und finanziell unterstützt wird: der "Volksbewegung gegen die EU", die seit 25 Jahren existiert; der "Juni-Bewegung", die sich vor der Volksabstimmung über den Maastricht-Vertrag 1992 gebildet hat, den nationalistischen Unionsgegner des "Notwendige Forums" aus Jütland und der "Gewerkschaftsbewegung gegen die Union".
Wie ist die Anti-EU-Bewegung politisch einzuordnen?
Die Volksbewegung will unbedingt aus der EU raus. Dänemark und EU, das ist für sie wie Feuer und Wasser. Die Juni-Bewegung dagegen vertritt auch Leute, die die frühere EG als Binnenmarkt akzeptieren, aber gegen eine monetäre und politische Union sind. Die Juni-Bewegung hat sich Anfang der neunziger Jahre von der Volksbewegung abgespalten.
Dominiert in der Bewegung eine politische Partei?
Seit Beginn haben sich alle möglichen politischen Kräfte daran beteiligt, sogar die Sozialdemokraten. Als sie dann umschwenkten, bekamen sie Probleme mit ihren Wählern und erzielten 1994 das schlechteste Ergebnis seit 60 Jahren. Nach Meinungsumfragen sind rund die Hälfte der sozialdemokratischen Wähler gegen die EU.
Die Volksbewegung hat sich aber insgesamt quer zu den politischen Parteien organisiert. Dort gibt es Konservative, Liberale, Linke und sogar Rechtsradikale. Und alle wollen aus der EU heraus. Die Regierung sagt wiederum, daß die Volksbewegung von linken Kräften, wie z.B. der dänischen KP, infiltriert sei.
Wie können Linke mit Rechtsradikalen zusammenarbeiten?
Das ist eine sehr schwierige Konstellation. Die Unterschiede sind oftmals sehr groß. In Dänemark gibt es auch Parteien, die der DVU und den Republikanern in Deutschland ähneln: die Dänische Volkspartei und die Fortschrittspartei. Die sind mit einer linken Partei wie der Enhedslisten natürlich verfeindet.
Aber in der Volksbewegung gegen die EU arbeiten sie trotzdem zusammen.
Ja, es gibt in der Volksbewegung auch Leute von der Dänischen Volkspartei, was sehr problematisch ist. An der Basis klappt die Zusammenarbeit noch ganz gut. Aber je höher die Hierarchie, desto schlechter ist die Kooperation. Dennoch: Es gibt einen gemeinsamen Nenner, und deshalb geht es trotzdem.
Und was ist der gemeinsame Nenner?
Das Wort "Union" ist in Dänemark ein Schimpfwort. Die EU unterdrückt die nationale Unabhängigkeit. Wir haben nichts gegen eine internationale Zusammenarbeit, aber wir wollen uns keine Beschlüsse von Brüssel aufzwingen lassen. Das dänische Parlament soll der Ausgangspunkt für die dänische Politik sein.
Das gilt für alle EU-Gegner, deshalb können sie auch in der Volksbewegung und in den lokalen Anti-EU-Gruppen zusammenarbeiten. Und die Leute von der Dänischen Volkspartei halten sich dort auch mit ihren Meinungen über Flüchtlinge und Ausländer zurück. Die Anhänger der EU haben übrigens das gleiche Problem: Auch dort gibt es große Meinungsunterschiede.
Hat die Enhedslisten nicht Angst, mit den Rechten in einen Topf geworfen zu werden oder sogar deren Argumente zu bekräftigen?
Ja, das ist eine Gefahr. Bei der Volksabstimmung über die EU am 28. Mai, die mit einem knappen Sieg der Befürworter endete, war die Grenzproblematik das Hauptthema. Damals haben die Rechtsradikalen gesagt: Wir wollen unter keinen Umständen Flüchtlinge und Asylanten, deshalb müssen wir die Grenze absperren. Das Schengener Abkommen und der Amsterdamer Vertrag bedeuten in ihren Augen eine Öffnung der Grenzen; dann würden die Asylantenfluten über Dänemark hereinbrechen.
Was war die Antwort der Enhedslisten auf diese Propaganda?
Dänemark muß die Flüchtlinge aufnehmen, aber aus eigener Entscheidung, und nicht, weil die EU uns das vorschreibt. Im Gegenteil: Die EU geht in dieser Hinsicht nicht weit genug, sie ist reaktionär. Eine Union, die sich gegen Flüchtlinge abschottet, wollen wir nicht. Wir haben auch versucht, die europäische Sicherheitspolitik mit Schengen, Europol etc. in den Wahlkampf hineinzutragen.
Liegt in der Anti-EU-Kampagne nicht die Gefahr, den Nationalismus zu bestärken?
Ja. Wir sind ja keine Nationalisten, die Dänemark für Fremde verschließen möchten. Wir wollen keine Festung Europa. Wir haben klar gesagt, was wir wollen, aber das wurde von den Wählern vielleicht nicht so gut verstanden. Die Öffentlichkeit ist sehr an der Grenzfrage interessiert, während wir in der Enhedslisten auch ganz andere Bereiche diskutieren möchten, z.B. die Währungsunion und die neoliberale Politik, die dahinter steht.
Eine andere Frage, der sich linke EU-Gegner stellen müssen: Wieso ist die Ablehnung in den reichen Ländern besonders stark? In Deutschland resultiert die Abneigung gegen die EU auch aus einem Wohlstandschauvinismus.
Dänemark ist ein Agrarland und bekommt daher hohe Subventionen aus Brüssel. Nächstes Jahr werden wir 13,1 Milliarden Kronen an die EU zahlen und ungefähr die gleiche Summe zurückbekommen. Aber das wird sich in Zukunft ändern, und wir werden mehr an die EU zahlen müssen als wir zurückerhalten. Dann haben wir dasselbe Problem wie Deutschland. Die EU wird dadurch sicherlich noch mehr an Popularität verlieren.
Deutschland ist die dominante Macht in der EU. Spielt das eine Rolle?
Die Parteien beobachten genau, was in Deutschland passiert, schließlich ist das Land ein Schwergewicht in der EU. Aber grundsätzlich gibt es keine deutsch-feindliche Stimmung. Die EU-Befürworter haben im Wahlkampf behauptet, mit dem Amsterdamer Vertrag sei der Ausbau der EU beendet. Wir haben gesagt, wenn die Deutschen die Präsidentschaft übernehmen, wird die Entwicklung weitergehen. Kohl oder Schröder wollen wahrscheinlich eine noch stärkere europäische Integration. Die dänische Regierung hatte dem widersprochen. Jetzt hat sie das Problem, daß sich ihre Aussagen nicht bewahrheiten werden.
Würde mit dem Ausscheiden Dänemarks die führende Rolle Deutschlands nicht unterstützt?
Deutschland hat schon jetzt eine führende Rolle, z.B. heißt in Dänemark das Schlüsselwort der Regierung derzeit Subsidiarität, ebenso wie in Deutschland. Und natürlich ist Deutschland ein Trendsetter in der EU - wenn in allen Staaten plötzlich über diesen Begriff geredet wird, dann liegt es daran, das Bundeskanzler Kohl ihn vor einigen Monaten eingeführt hat, um die EU populärer zu machen.
Aber tatsächlich findet eine Ausweitung der EU-Kompetenzen statt. Die dänische Regierung sagt z.B., daß Europol eine notwendige Einrichtung sei, um die grenzüberschreitende Kriminalität zu bekämpfen. Aber was steckt dahinter? Mit dem Schengener Informationssystem kann man alle Bürger in Europa bespitzeln. Die Grenzen werden zwar aufgehoben, aber was ist der Ersatz dafür? Die Kontrollen finden bis weit hinter die Grenzen statt.
In der deutschen Linken gibt es die Meinung, daß die Einbindung Deutschlands in die EU sinnvoll ist, weil seine Macht dadurch begrenzt und besser zu kontrollieren sei ...
Dieses Argument kennen wir natürlich auch. Aber ich sehe das differenzierter. Die EU ist nicht nur ein Einbindungsinstrument, sondern auch eine Plattform für eine selbständige nationale deutsche Politik. Deutschland kann aus meiner Sicht nicht im Alleingang im Kosovo intervenieren - aber mit einer EU-Unterstützung wäre das möglich. Die EU kann ein Sprungbrett für eine selbständige nationale Politik sein.
Die Nationalstaaten haben immer weniger Bedeutung, die Kontrolle über die Sozial- und Wirtschaftspolitik liegt zunehmend außerhalb staatlicher Instanzen. Der Versuch, diese Entwicklung umzudrehen, entspringt doch einer anachronistischen Haltung.
Die Globalisierung hat erst in den letzten zehn, fünfzehn Jahren ihre jetzige Bedeutung erhalten. Es hängt auch von dem politischen Willen ab, diese Entwicklung zu beeinflussen. Kann die EU die Globalisierung bekämpfen? Haben diese Leute überhaupt den Willen, das Monopolkapital zu bekämpfen?
Aber diesen Willen haben nationale Politiker auch nicht.
Dieselben Politiker, die auf nationaler Ebene das Monopolkapital nicht bekämpfen, werden dies auch nicht in der EU machen. Die EU wird daher keinen Schutz gegen die Globalisierung bieten.
Dann könnte man auch sagen, daß es eigentlich egal ist, ob Politik im nationalen oder im Rahmen der EU stattfindet.
Ich glaube schon, daß im nationalen Rahmen mehr politischer Einfluß möglich ist. Um den negativen Folgen der Globalisierung etwas entgegenzusetzen, sind die Gewerkschaften wichtiger als die Parlamente. Die Mehrheit der EU-Parlamentarier sind Sozialdemokraten oder Mitglieder konservativer Parteien, die nichts gegen das Monopolkapital unternehmen werden. Eine internationale Zuammenarbeit der Gewerkschaften wäre da viel effektiver.