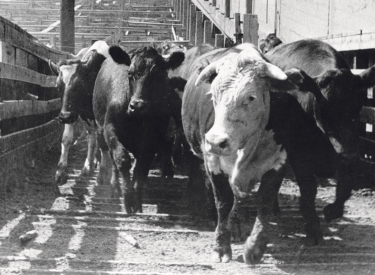Statthalter des Gewöhnlichen
Pop ist angewandter Größenwahn, Glamour, Verschwendung. Alles, was darüber hinaus für Pop gehalten wird, ist womöglich bloß Musik. Wer sich ohnehin mit ihr bescheiden will, wird zu Sublimerem greifen als zu Pop, dessen Würze gerade im Nicht-Musikalischen liegt, um nicht zu sagen: in seiner Unverschämtheit.
Wer das so wie ich sieht, dem mag neben den furchteinflößenden Akteuren der Prodigy in ihrem Video "Firestarter" ein magerer blondierter Mann aufgefallen sein. Er trägt einen selbstgestrickten Pullover und sieht aus wie einer, der statt Kaffee lieber aromatisierten Tee trinkt. Ein verkiffter Kabelträger vielleicht, der versehentlich ins Bild geraten ist und der den ganzen schönen Horror durch seine offenkundige Harmlosigkeit wieder aufzuheben droht. Auf der Straße würde man diesen Hippie keines Blickes würdigen, und in dem Video fällt er nur durch seine Deplaziertheit auf. Es ist Liam Howlett, der Komponist, Texter, Musiker, Mixer, Art Director und Produzent von Prodigy.
Da wir uns seit den Monkeys von dem Irrglauben verabschiedet haben, der Popstar müsse sich selbst erfunden, seine Musik selbst geschrieben oder selbst gespielt haben, stellt sich die Frage, warum der Produzent von Prodigy in deren Video mitspielt? Wann ist denn Phil Spector je mit einer seiner Gruppen aufgetreten? Hätten wir statt den New Kids on the Block lieber ihren Erfinder Maurice Starr, einen mittelmäßigen Soul-Musiker, statt Boney M. lieber den Schlagersänger Frank Farian angeschaut? Wie ist dieser Verstoß gegen das Grundgesetz des Pop zu erklären? Was entschuldigt die Verwässerung des Phantastischen durch das Glaubhafte? Ist es erlaubt, neben das überlebensgroß Böse (Prodigy-Darsteller Keith Flint) einen man of the crowd (Prodigy-Autor Liam Howlett) zu stellen?
Die Beantwortung dieser Fragen führt uns zurück in die frühen Sechziger. In den USA machte damals der hübsche Einfall Furore, auf Surf Music - ursprünglich aggressive Gitarren-Instrumentals - Texte zu schreiben. Sie handeln von gutaussehenden jungen Herumtreibern aus gutem Hause, die außer mit Surfen ihre Sommertage mit Partys, Umherfahren in Papis Limousine und dem Verführen gutaussehender Mädchen verbummeln, die ihrerseits auf niemand anderen gewartet zu haben scheinen. Dargestellt wurde diese Phantasie von einer Gruppe gutaussehender junger Männer, die den Eindruck erweckten, Herumtreiber aus gutem Hause zu sein, die außer mit Surfen ihre Sommertage mit Partys, Umherfahren in Papis Limousine und dem Verführen gutaussehender Mädchen verbummelten, die ihrerseits auf niemand anderen gewartet zu haben schienen. Die Gruppe nannte sich Beach Boys.
Einer wollte freilich nicht ganz in das Bild passen. Zum Surfen war er schon zu fett, zum Verführen zu schüchtern, und wenn er in einer Limousine umherfuhr, dann sicherlich in einer rundum geschlossenen, mit verspiegelten Panzerglasscheiben. Brian Wilson allerdings hatte sich das alles ausgedacht, ohne ihn hätte es die Beach Boys nicht gegeben. Mit der Zeit wurde seine Rolle als éminence grise im Hintergrund, die die ganze Szene arrangiert hatte, immer deutlicher. Im Rückblick konnte sich der Fan erklären, was dieser dickliche Sänger bei einer Gruppe sportlicher Mädchenlieblinge verloren hatte (Brians Bruder Carl, muß ich nach einem zweiten Blick auf die Cover ergänzen, paßte ebenfalls nicht ganz ins Bild, fiel aber nicht weiter auf). Der Fan erahnte das Geheimnis dessen, der prima vista dem Gesetz des Pop zu widersprechen schien. Sein Geheimnis enthüllte sich als ebenso geniales wie tragisches Schöpfertum, sicherlich ein Klischee, sicherlich Pop. Nik Cohn hat in "Rock Dreams" Brian Wilsons grandiose Einsamkeit so imaginiert: "Ferienzeit: Während Carl für 1 Dollar die Stunde an der Tankstelle arbeitet, Danny mit seinem Auto unterwegs ist, sitzt Brian zu Hause in seinem Zimmer, allein mit seinen Gewichtsproblemen und seinem Ohrenleiden, seiner pathologischen Schüchternheit und träumt seine Lieder über das, was draußen passiert."
Die anderen, auf Wellen und in Limousinen leicht dahingleitend, wären gar nicht darauf verfallen, Hymnen auf ihr kleines Leben mit seinen kleinen Problemen zu schreiben. Der, dem diese Leichtigkeit unerreichbar blieb, war dazu bestimmt, sie zu idealisieren. Als er begann, sich selbst zu besingen, wurde er schließlich doch zu einer phantastischen, überlebensgroßen Figur, wenn auch auf ganz andere Weise als die anderen, die glücklichen Surfer: Ihm blieb der Glamour der Melancholie vorbehalten. "Hang On To Your Ego" hieß es noch durchaus ironisch in einem (damals) nicht veröffentlichten Entwurf zu "Pet Sounds" (1966); "Smiley Smile" (1968), sein Meisterstück, hatte nur noch sein exzentrisches Ego zum Inhalt, der Rest der Gruppe war zum Chor degradiert, der Brian Wilsons harmonische Kühnheiten möglichst präzise darzubieten hatte. Aber hier verlassen wir schon den Pop in Richtung Musik.
Die Gegenspieler der Beach Boys in Großbritannien, die Beatles, gestatteten ebenfalls einem Unscheinbaren mitzutun: Ringo Starr war älter und nicht so sexy wie die anderen, er zog Alkohol den psychedelischen Drogen vor, er gab sich betont einfach und maulfaul. Anders als Brian Wilson war er aber kein begnadeter Musiker. Auf jeder Platte der Beatles ist er mit einem oder zwei Stücken vertreten, Country-Songs, schlichte Lieder, charmant, aber von der Finesse McCartneys oder der Schärfe Lennons weit entfernt. Starr war der Statthalter des Gewöhnlichen, der Anti-Star.
Innerhalb des Gefüges der Beatles hatte er durchaus seine Funktion. Er bildete das Gegengewicht zu den Dandys der Gruppe. Als den charakteristischen Zug des Dandys erkannte J.A. Barbey d'Aurevilly die Unverschämtheit. Die Unverschämtheit aber ist "die Schwester der Grazie, von der sie sich nicht trennen darf; die beiden steigern durch den Gegensatz wechselseitig ihre Schönheit" ("Vom Dandytum und von G. Brummel", 1844). Starr ermangelte der Unverschämtheit, die Lennon in reichem Maße besaß, so sehr wie der Grazie McCartneys. In Starr erkannte sich der brave Kerl wieder, der davon träumte, Star zu sein, ohne allzuviel riskieren zu müssen.
Solche Zwitterwesen - Star und Anti-Star zugleich - trifft man seither immer wieder im Pop an. Häufig sind es Drummer oder Bassisten, deren Straightness den Sängern und Gitarristen erlaubt, ihre Exaltiertheit besonders plastisch herauszustellen. Immer sind sie auch heimliche Verbündete der Fans, denen das bigger than life der großen Comicfiguren des Pop sonst allzu unglaubwürdig erschiene.
Maureen Tucker, die Schlagzeugerin des Velvet Underground, führte diese Figur zur Vollendung. In einem monotonen Bo-Diddley-Stil schlagend, fast klopfend, blieb sie schwarz und klein im Hintergrund, unscheinbar zwar, aber doch präsent. Auf dem Cover ihres eigenwilligen Solo-Albums "Playin' Possum" (1982) sieht man sie mit Dauerwellen, sie trägt ein Cord-Jackett und abgewetzte Jeans. Steif und unbeholfen sitzt sie auf einer Bank oder lehnt sie an einem Pfosten, sie spielt Billard und lächelt so uneitel wie möglich in die Kamera. Umso ungewöhnlicher dann die Platte, eine der extremsten Stilisierungen der Straightness, die ich kenne, und in dieser manieristischen Stilisierung sicherlich Pop.
Maureen Tucker ist nicht der Anti-Star für jedermann. Diese Rolle spielen mit großem Erfolg Phil Collins oder Joe Cocker, der sich für den Spiegel in seiner Einbauküche fotografieren ließ. Die beiden aber sind, meinen unerschütterlichen Prämissen zufolge, nicht mehr Pop; Gegenstand der Soziologie und nicht länger der Ästhetik.
Was die Ästhetik betrifft, zeigt sich, daß der Reflex der Oberfläche gelegentlich der Grundierung durch eine gewisse Mattheit bedarf, um umso heller strahlen zu können. So betrachtet, tragen auch die Unscheinbaren im Pop nur zu dessen grellem Spektakulum bei. Sie markieren die Scheideline zwischen Licht und Schatten, zwischen der Imago des Ungewöhnlichen, dem Star, und dem Gewöhnlichen selbst, dem Fan.

 Schlussakkord
Schlussakkord