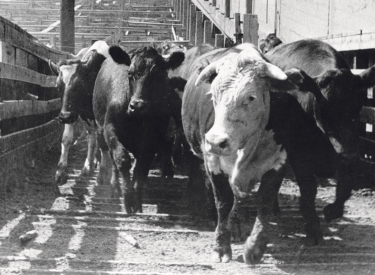Paradoxien des Geschlechts
Folgt man psychoanalytischen Theorien zur Subjektkonstruktion, so gibt es kein authentisches Selbst. Das Selbst konstituiert sich im Begehren des anderen auf dem Feld des Blicks. Dieses Begehren ist von zweifacher Art. Es sagt nicht nur: "Schau her, da begehrt jemand", sondern auch: "Sieh an, ich werde begehrt." "Jemand" ist die Andersheit des anderen; seine Fremdheit und "Ich" ist - nach Rimbaud - "ein Anderer".
Stimmig ist dies, wenn das Begehrensplateau heterosexuell definiert ist (was in den Texten die Regel ist). Was aber passiert mit dieser Subjektkonstruktion, wenn die, die sich da in den Blick genommen sieht, zwar leiblich eine Frau ist, ihre Geschlechtsidentität aber männlich ist - oder umgekehrt? Wen von beiden trifft dann der Blick?
Harkan und Jacqueline scheinen von solchen Fragen weit entfernt zu sein. Seit sie sich kennengelernt haben, sind sie unzertrennlich. Jacqueline ist eine Transsexuelle, die zum Zeitpunkt, als die Fotos von ihr und Harkan entstanden, die "geschlechtsangleichende" Operation noch nicht hatte durchführen lassen. "Es ist zwar belastend, aber die Operation ist nicht das Wichtigste, ich weiß ja, wer ich bin", heißt es in dem Katalog zur Ausstellung "Im falschen Körper. Transsexuelle Menschen in Deutschland" mit Bildern und Texten von Daniel und Geo Fuchs. Die Ausstellung, die 1995 zum ersten Mal im Frankfurt Römer zu sehen war, zeigt nun die Neue Gesellschaft für bildende Kunst (NGBK) in Zusammenarbeit mit dem Haus am Kleistpark, Kunstamt Schönberg. Die Arbeitsgruppe "Exkurse" hatte sich dazu entschlossen, diese Exposition der NGBK zur Übernahme vorzuschlagen, weil sie - entgegen der häufigen Verwechslung Transsexueller mit Transvestiten und dem damit einhergegehenden Vorurteil von schrillen Fummeltrinen - Transsexuelle in ihrer Alltäglichkeit mit ihren Alltäglichkeiten zeigt.
22 Frau-zu-Mann- und Mann-zu-Frau-Transsexuelle werden in 88 Schwarz-Weiß-Fotografien gezeigt. Darunter auch Cassandra und Dana.
Daniel und Geo Fuchs haben Cassandra 1993 auf dem Frankfurter Bahnhofstrich kennengelernt, als die beiden Journalisten an einem Projekt zur Prostitution von Männern arbeiteten. Zu diesem Zeitpunkt sah Cassandra noch aus wie ein Mann. Das letzte Foto der damals entstandenen Serie ist eine Aufnahme aus dem Jahr 1995, als sie begriffen hatte, "daß sie als Frau, als Cassandra, leben will".
Dana, die seit der Hamburger Station der Fotoschau, 1996, mit vertreten ist, war zunächst in einer Fotoausstellung über Obdachlose von Daniel und Geo Fuchs zu sehen.
Beide Beispiele sind wichtig, weil sie Auskunft geben über die Arbeitsweise von Daniel und Geo Fuchs. Auch wenn Geo Fuchs sagt, daß der Anlaß für die Idee und die Konzeption der Ausstellung über Transsexuelle ein Rundfunkinterview mit (man könnte fast sagen: wie sollte es anders sein) Charlotte von Mahlsdorf war, belegt die Themenwahl ein dauerhaftes Engagement, immer verbunden mit ausführlichen Recherchen. Soziale Fotografie forscht nach den Menschen und ihren Lebenswirklichkeiten im urbanen Umfeld.
Da ist z.B. Elvira P., die in einem gruselig matronenhaften Kleid inmitten ihrer Sammlung diverser Sportabzeichen posiert, oder Mario H., der nach seiner Lehre am liebsten auf dem Bau arbeiten will und jetzt schon 90 Liegestützen schafft. Die Frauen und Männer werden nicht vorgeführt oder ausgestellt. Ganz bewußt wurden sie so fotografiert, daß sie die Betrachter und Betrachterinnen direkt anschauen, und folgerichtig hängen die Bilder in dieser Ausstellung auf Augenhöhe.
Mit dieser Inszenierung wird etwas in Gang gesetzt, was präzise mit dem Begehren des anderen auf dem Feld des Blicks - und damit mit Subjektkonstruktionen - zu tun hat. Die Befragung, wenn nicht gar Hinterfragung des "Selbst" oder auch des "Ich", wird zurückgegeben. Denn es ist eine Sache, über gender trouble, cross dressing oder cross gendering zu theoretisieren (und ohne Judith Butler nicht mehr über Geschlechtsidentitäten schreiben zu können). Wenn aber, wie Gesa Lindemann in ihrem Buch "Das paradoxe Geschlecht. Transsexualität im Spannungsfeld von Körper, Leib und Gefühl" schreibt, "das Wahrgenommenwerden durch andere in die eigene Leiberfahrung eingeschrieben, in ihr 'verkörpert' ist", dann ist die Irritation heillos, wenn man/frau nicht eindeutig sagen - besser: sehen kann -, welches Geschlecht der/die Wahrnehmende hat. Die binäre Geschlechterkonstruktion, die unsere Kultur (noch) determiniert, ist nicht einfach mit gutem Willen beiseite zu schieben. Und die Tatsache, daß es Menschen gibt, die ihr Geschlecht wechseln und dafür um Akzeptanz kämpfen, ändert daran ... nichts? wenig? einiges? Oder alles?
"Das Verrückte am Transsexualismus ist, daß die Transsexuellen nicht verrückt sind", schreibt Volkmar Sigusch in "Geschlechtswechsel", und weiter: "Ihre seelische Verfaßtheit ist kein 'Irrtum' der Natur, sondern ein 'Kunstwerk' des Menschen." Das "Kunstwerk" daran ist, die Versicherungen der Normalität zu verdrängen.
"Transsexuelle Menschen in Deutschland: Im falschen Körper". Fotografien und Texte von Daniel und Geo Fuchs. NGBK, Oranienstr. 25, Berlin. Dienstags bis sonntags 12-18 Uhr, mittwochs 12-20 Uhr. Bis 2. November

 Schlussakkord
Schlussakkord