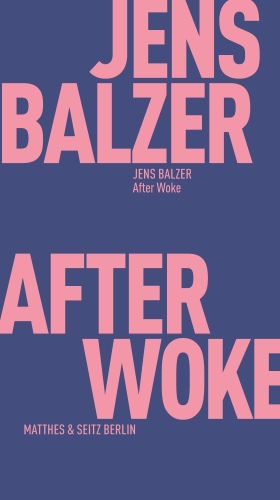https://shop.jungle.world/artikel/2024/34/jens-balzer-die-woke-linke-ist-im-eimer
»Die ›woke‹ Linke ist im Eimer«
In seinem Buch »After Woke« treibt den Schriftsteller und Journalisten Jens Balzer die Frage um, warum gerade diejenigen, die lange als Protagonisten der politischen Emanzipation galten, so anfällig sind für regressives Denken. Ein Gespräch über die Zäsur des 7. Oktober, verhärtete Identitäten und die Frage, gegen wen eine »woke« Diskursethik unbedingt zu verteidigen ist.
In Ihrem Buch schreiben Sie, dass »Wokeness« in ihrem zunächst emanzipatorischen Sinne für Sie eine wichtige kulturelle und intellektuelle Referenz darstellt. Mit dem 7. Oktober habe sich aber Grundlegendes verändert. Was genau ist da passiert?
Da wurde der moralische Bankrott großer Teile der sich als »woke« verstehenden Szene sichtbar, und genau aus der Erschütterung darüber habe ich das Buch geschrieben: dass ausgerechnet Menschen, die sich als besonders sensibel, progressiv und emanzipiert verstehen, zuerst zu den Massakern der Hamas, auch zur sexualisierten Gewalt, einfach geschwiegen haben. Und kurz darauf haben sie angefangen, diese Taten als Teil des antikolonialen Befreiungskampfes zu interpretieren und sogar richtig zu feiern. Ein sehr lauter Teil dieser »woken« Community ist nicht willens, sich mit den Opfern zu solidarisieren, und nicht nur das, sie erkennen sie gar nicht erst als Opfer an, weil in ihrem Gedankengebäude Jüdinnen und Juden ausschließlich als weiße Täter kolonialistischer Verbrechen gelten. Und damit sehen sie sämtliche Formen der Gewalt als gerechtfertigt an. Das war ein Schock, den man erst mal verarbeiten muss, wirklich eine massive Enttäuschung.
Der Begriff »woke« ist inzwischen ohnehin verbraucht, niemand bezeichnet sich mehr ernsthaft selbst so. Im Buchhandel findet man zur Zeit aber viele Werke, die die Ideen von »Wokeness« angreifen und lächerlich machen oder sogar dämonisieren. Woher kommt der Begriff »woke« überhaupt?
Zuerst tauchte »woke« 1938 in einem Blues-Song von Lead Belly auf. Da ging es um einen typischen rassistischen Justizskandal in den Südstaaten der USA. Eine Gruppe junger schwarzer Männer war in Scottsboro, Alabama, zu Unrecht der Vergewaltigung zweier weißer Frauen angeklagt worden. In dem Song werden alle Schwarzen aufgefordert, einen Bogen um Alabama zu machen oder, wenn sie das Pech haben, dort leben zu müssen, generell besonders wachsam für rassistische Gefährdungen zu sein. Seitdem geistert der Begriff durch die Geschichte, mit ganz unterschiedlichen Aneignungen.
Erykah Badu hat 2008 den Song »Master Teacher« mit der Zeile »I stay woke« veröffentlicht, da geht es auch um die selbstreflexive Komponente, also sich zu fragen, ob man achtsam genug ist, um nicht nur die eigene Diskriminierung, sondern auch die Diskriminierung anderer wahrzunehmen. 2014 wurde der Begriff »woke« zum Slogan der Black-Lives-Matter-Bewegung. Gleichzeitig wurden konservative und rechte Kulturkämpfer darauf aufmerksam, die »woke« als diffusen Sammelbegriff für Strömungen der progressiven Linken benutzen, die sie diskreditieren möchten.
Black Lives Matter gilt als eine Art Höhepunkt der »woken« Bewegung, aber schon damals kam es zu offen antisemitischen Äußerungen. Was läuft da schief?
Schon in den neunziger Jahren haben postkoloniale Theoretiker wie Henry Louis Gates, Jr. und Cornel West davor gewarnt, dass der zunehmende Antisemitismus in der afroamerikanischen Community die Legitimität des eigenen Emanzipationskampfes zu beschädigen begann. Bereits seit den sechziger Jahren gab es in der afroamerikanischen Bürgerrechtsbewegung diesen Strang, vor allem mit der Nation of Islam, deren antisemitische Pamphlete den »Protokollen der Weisen von Zion« oft nicht unähnlich sind. Da wurde verbreitet, der koloniale Sklavenhandel sei wesentlich von Juden organisiert worden. West beschreibt das als kalkulierte Fragmentierung und Entsolidarisierung marginalisierter Gruppen durch die Führer der Nation of Islam, damit es leichter fällt, sich selbst an die Spitze der Emanzipationsbewegung zu setzen. Da geht es um Verteilungskämpfe und Opferhierarchien.
Dieser antisemitische Unterstrom hat sich fortgesetzt bis hin zu Black Lives Matter, auch wenn es dabei zunächst gar nicht um Israel ging. Erst in den zehner Jahren wurde der israelbezogene Antisemitismus auf die ältere antisemitische Tradition aufgesetzt. 2015 wurde die Bewegung von antisemitischen Akteuren dann komplett gehijackt. Die Folge sehen wir an den Unis der Ost- und Westküste der USA, da ist diese Form des Antisemitismus besonders stark vertreten.
In Ihrem Buch beziehen Sie sich positiv auf Jürgen Habermas, um ein anderes Verständnis von »Wokeness« darzulegen. Allerdings hat Habermas den Begriff niemals verwendet. Wie lässt sich mit Habermas ein gescheitertes Konzept retten?
Ich habe seine »Diskursethik« aus den sechziger Jahren herangezogen, um den Begriff im Sinne seiner eigentlich positiven Bedeutung zu interpretieren. Habermas’ Theorie des kommunikativen Handelns beschreibt ja eigentlich den Kern der republikanischen, liberalen Demokratie – und ich glaube, um nichts anderes geht es bei einer recht verstandenen »Wokeness« auch. Es geht darum, dass alle an öffentlichen Debatten teilnehmen können, unabhängig von sozialem Status, Rassifizierung, geschlechtlicher Orientierung und so weiter. Was bei Habermas etwas zu kurz kommt, ist die Beschäftigung mit der Frage, wie die Infrastruktur umzugestalten wäre, um dies zu ermöglichen.
»Lange verstand man Identität als etwas Offenes, Hybrides. So haben das zum Beispiel Stuart Hall, Bell Hooks oder Paul Gilroy beschrieben. Identität galt als etwas Werdendes, sie kam eigentlich aus der Zukunft.«
Hingegen gehört zu seinem Verständnis eines gerechten Diskurses von vornherein auch die Aufforderung an jeden einzelnen Diskursteilnehmer, sich selbst auf die eigenen Vorurteile und Verkürzungen des Blicks auf die Welt unentwegt zu hinterfragen. Selbstkritik also – die gehörte in den besseren Zeiten der linken Bewegung immer dazu, und das ist gerade das, was mir in diesem Endstadium der »woken« Bewegung komplett verloren gegangen zu sein scheint. Wenn es infolge identitärer Verhärtung immer nur darum geht, wer aus welcher Position spricht, tauscht man letztlich nur noch Argumente ad hominem aus. Das verzerrt den Diskurs. Man läuft Gefahr, genau das zu reproduzieren, was man »weißen Suprematisten« vorwirft, nur auf eine andere Art. Das Ganze ist dem nicht unähnlich, was man bei den rechten Identitären beobachten kann.
Sie kritisieren, dass »Wokeness« heute deutlich rückwärtsgewandt ist und mit Vorstellungen von Ursprünglichkeit oder Indigenität verbunden wird. Progressiv ist diese Bewegung also nicht mehr. Inwiefern aber war sie je progressiv?
Sie war progressiv, so lange sie Identität als etwas Offenes, Hybrides verstand. So haben das zum Beispiel Stuart Hall, Bell Hooks oder Paul Gilroy beschrieben. Identität galt als etwas Werdendes, sie kam eigentlich aus der Zukunft. Es ging darum, Konzepte ethnischer Homogenität zu überwinden, die ihren Ursprung im Kolonialismus haben. Das wurde dann irgendwann in den späten nuller Jahren abgelöst durch eine sehr starke Fokussierung auf das Ursprüngliche, Authentische, das sogenannte Indigene. Das konnte man im Kunstbetrieb zuletzt bei der Documenta sehen, bei der Biennale in Venedig, im Berliner Haus der Kulturen der Welt und so weiter; auch in der postkolonialen Theorie – etwa in den jüngeren Büchern von Gayatri Spivak – ist das zu einem Leitbegriff geworden. Und zu einer Schablone, die oft einfach nicht passt, zum Beispiel wenn die Palästinenser als indigene Bevölkerung der Levante dargestellt werden und die Juden als Kolonisatoren, das geht haarsträubend an der historischen Realität vorbei. Und generell gilt, wenn man den Begriff Identität so verhärtet definiert und nur von der Vergangenheit aus, dann landet man letztlich wieder beim Völkischen, Territorialen, bei der Scholle. Mit diesem neuen Nostalgie- und Herkunftsfimmel wird die späte »woke« Linke den Rechten sehr ähnlich.
Auf Demonstrationen zeigen sich queere Menschen immer häufiger gemeinsam mit Islamisten. Beim Berliner Dyke March wurde sogar eine »Flintifada« gefordert. Wie erklären Sie sich solche Allianzen?
Es ist offenkundig, dass dem gegenwärtig herrschenden – sagen wir mal – vulgär-postkolonialen Strang des »woken« Denkens eine sehr überschaubare Schwarzweißpolarisierung zugrunde liegt. Narrative der schwarzen Bürgerrechtsbewegung werden auf Zusammenhänge aufgesetzt, auf die sie gar nicht passen. So werden Palästinenser als kolonialisierte »Schwarze« gesehen, die von jüdischen »Weißen« unterdrückt werden. Als fände jetzt der alles entscheidende Endkampf des Globalen Südens gegen den Norden statt. Diese eschatologische Aufladung ist so massiv, dass alles andere in den Hintergrund gerückt wird. Damit werden dann aber auch der Feminismus und die queere Emanzipation offenkundig wieder zu Nebenwidersprüchen – wie in der marxistischen Linken schon mal bis in die sechziger Jahre hinein. Eine Linke, die es wieder so weit kommen lässt, ist selbst schuld an ihrem eigenen Untergang.
Der Titel Ihres Buchs lautet »After Woke«. Was kommt also danach, welche Perspektive hat die Linke denn?
Die »woke« Linke ist im Eimer. Ich glaube, da ist nichts mehr zu retten, auch nicht an dem Begriff. Ich hoffe zugleich aber, dass progressiven Linken, die noch einigermaßen bei Verstand sind, aber auch Konservativen klar wird, dass sich auch nach dem moralischen Bankrott der »woken« Szene der Kern dessen, worum es da eigentlich mal ging, nicht erledigt hat: Selbst wenn man – sagen wir mal – die »Queers for Palestine« noch so irre und heuchlerisch findet, so bleibt es dabei, dass die Rechte von Menschen, die sich nicht dem heterosexuellen Imperativ unterwerfen, unbedingt verteidigt werden müssen.
»Die Rechte von queeren Menschen und Frauen sind aber auch gegen den politischen Islam zu verteidigen. Der gerade noch vereitelte Anschlag auf die Taylor-Swift-Konzerte in Wien hat die Bedrohung einmal mehr deutlich gemacht.«
Denn dabei geht es auch um die Verteidigung der liberalen Demokratie im Ganzen – in Russland werden queere Menschen ja nicht umsonst als Symptom des dekadenten Westens diskreditiert. Man muss aber nicht mal bis nach Russland gehen, es reicht schon Bautzen, wie wir beim dortigen CSD gesehen haben. Die Rechte von queeren Menschen und Frauen sind aber auch gegen den politischen Islam zu verteidigen. Der gerade noch vereitelte Anschlag auf die Taylor-Swift-Konzerte in Wien hat die Bedrohung einmal mehr deutlich gemacht. Es ist ja kein Zufall, dass es immer wieder um Festivals und Clubs geht bei solchen Terroranschlägen.
Woran lässt sich denn in dieser Situation anknüpfen?
Es gibt vereinzelt Menschen oder auch Orte, wie das About Blank in Berlin, die sich trauen, Stellung zu beziehen gegen diese sich so hegemonial und selbstverständlich gebenden antisemitischen Tendenzen in der Linken. Es rumort ein bisschen, das gibt mir etwas Hoffnung. Und ich hoffe, allen Linken, die noch die Fähigkeit zur Selbstreflexion besitzen, und allen liberal-konservativen Kräften, die guten Willens sind, deutlich machen zu können, dass auch nichts dadurch gewonnen ist, wenn man alles, was als »woke« gilt, in die Tonne tritt.
Jens Balzer: After Woke. Matthes & Seitz, Berlin 2024, 105 Seiten, 12 Euro
Buchvorstellung: Mittwoch 11.09.2024, 19 Uhr, in der »Taz«-Kantine, Friedrichstr. 21, 10969 Berlin, Eintritt frei