
https://shop.jungle.world/artikel/2020/46/vor-der-eigenen-haustuer-kehren
Vor der eigenen Haustür kehren
Es gilt, mit der antirassistischen Utopie von einer Welt ohne Grenzen gegen den Frust anzukämpfen.
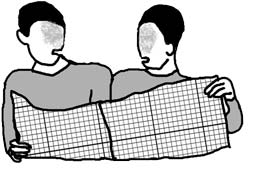 Welche Handlungsmöglichkeiten haben soziale Bewegungen gegen die derzeitige europäische Migrationspolitik? Christian Jakob sah neue politische Spielräume (Besser weitermachen), Anna Jikhareva eine Chance in der Zusammenarbeit der Flüchtlingsbewegung mit Black Lives Matter und Klimabewegung (Bildet Banden). Krsto Lazarević erinnerte daran, dass es manchmal schon viel ist, wenn man das Schlimmste verhindern kann (Geduldig gegen die Festung Europa).
Welche Handlungsmöglichkeiten haben soziale Bewegungen gegen die derzeitige europäische Migrationspolitik? Christian Jakob sah neue politische Spielräume (Besser weitermachen), Anna Jikhareva eine Chance in der Zusammenarbeit der Flüchtlingsbewegung mit Black Lives Matter und Klimabewegung (Bildet Banden). Krsto Lazarević erinnerte daran, dass es manchmal schon viel ist, wenn man das Schlimmste verhindern kann (Geduldig gegen die Festung Europa).
Die Lage ist nicht rosig, aber auch nicht schlimmer als früher. Man muss Christian Jakobs Optimismus (Jungle World 43/2020) nicht gänzlich teilen, es hilft aber, die Perspektive zu verschieben: Die Bedingungen für antirassistische Arbeit waren in Deutschland noch nie besonders gut. Seit dem sogenannten Asylkompromiss 1993 wurden vor allem Abwehrkämpfe gegen immer neue Gesetzesverschärfungen geführt. Das macht die Arbeit zwar sehr frustrierend, aber umso wichtiger. Denn wer weiß, was sich ohne diese Kämpfe noch alles verschlechtert hätte? Oder wie es Krsto Lazarević treffend ausgedrückt hat: Es geht erst einmal darum, das Schlimmste zu verhindern. Das ist heute auch nicht anders als vor 20 Jahren.
Antira erfordert einen langen Atem. Ein Beispiel dafür ist das Asylbewerberleistungsgesetz: Seit seiner Einführung 1993 kämpfte die deutsche antirassistische Bewegung gegen dieses Gesetz. Es ermöglichte Geflüchteten keine menschenwürdige Existenz in Deutschland und verwehrte ihnen vielmehr bewusst gesellschaftliche Teilhabe. Nachdem es über Jahre kaum öffentliche Aufmerksamkeit für dieses Gesetz und seine Folgen gab, erklärte das Bundesverfassungsgericht es 2012 für verfassungswidrig – durchaus ein Erfolg der stetigen Arbeit von Flüchtlingsinitiativen. Diesen Erfolg relativierten allerdings in den Jahren seit 2015 neue Verschärfungen.
Der Blick der antirassistischen Bewegung sollte sich wieder verstärkt auf die deutschen Zustände richten. Denn selbst wenn es gelänge, die Bundesregierung dazu zu bewegen, sämtliche Menschen aus dem abgebrannten Camp Moria und den anderen Lagern aufzunehmen – was hieße das denn? Doch nur, dass die Menschen hier in Lager gesteckt würden. Diese sind zwar in weniger katastrophalen Zustand als jene auf den Mittelmeerinseln, aber mit menschenwürdiger Unterbringung hat das immer noch nichts zu tun. Auch hier würde diesen Menschen die Teilhabe verweigert.
Die Covid-19-Pandemie hat die Situation in den Unterkünften in Deutschland weiter verschärft. Und sicher sind Geflüchtete hierzulande auch nicht, da Deutschland immer mehr Länder als »sichere Herkunftsstaaten« einstuft. Selbst Menschen aus dem Bürgerkriegsland Syrien erhalten nur subsidiären Schutz, der mit mehr Unsicherheiten behaftet ist als beispielsweise der, den ein anerkannter Anspruch auf Asyl gewährt. Erst im Oktober forderte Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU), in bestimmte Teile Syriens abzuschieben.
Zwar hat Lazarević recht damit, dass Moria ein Symbol für die menschenverachtende Flüchtlingspolitik der EU und ihrer Mitgliedsstaaten ist. Ein solches Symbol ist wichtig für Menschen, die sich nicht kontinuierlich mit Migrationspolitik befassen. Die Fokussierung auf Symbolorte an den Außengrenzen der EU, die aus deutscher Perspektive weit entfernt sind, kann aber einen problematischen Entlastungseffekt haben. Der Umgang mit Geflüchteten wird dann zu einer griechischen, italienischen oder ungarischen Angelegenheit, die entweder »uns« hier nicht direkt etwas angeht oder auf die man von hier aus kaum Einfluss zu haben scheint. Zudem ist es immer einfacher, mit dem Finger auf andere zu zeigen. Dass die Zustände an den Außengrenzen unter anderem ein Resultat der Dublin-Regelungen sind, wird dabei schnell vergessen. Diese legen fest, dass Asylsuchende im ersten »sicheren« EU-Staat, den sie betreten, Asyl beantragen müssen. Dies verlagert das »Flüchtlingsproblem« in die Staaten an den Außengrenzen der EU und entlastet Deutschland, da es von EU-Staaten umgeben ist.
Neben Seenotrettung und Moria sollten die Menschenrechtsverletzungen, die jeden Tag in Deutschland begangen werden, wieder stärker in den Blick rücken.
Viele geflüchtete Menschen, die es nach Deutschland geschafft haben, leben unter unwürdigen Bedingungen und müssen ständig mit einer Abschiebung in noch schlimmere Zustände rechnen. Das gilt etwa für viele Angehörige der Roma-Minderheiten, die aus den Westbalkanstaaten nach Deutschland geflohen sind – manche während des Kosovo-Kriegs 1999, viele vor der starken Diskriminierung der Minderheiten in den Nachfolgestaaten Jugoslawiens, die bis heute anhält. Mit der Einstufung all dieser Länder als »sichere Herkunftsstaaten« haben diese Menschen kaum mehr eine Chance auf Asyl. Gerade in Deutschland müsste das wegen der Verfolgung der Roma während des Nationalsozialismus als Skandal gelten. Stattdessen werden diese Menschen als »Wirtschaftsflüchtlinge« denunziert, das Problem findet kaum öffentliche Aufmerksamkeit. Sich für ein dauerhaftes Bleiberecht für sie einzusetzen, wäre ein antirassistisches Anliegen, das nicht an den europäischen Außengrenzen, sondern direkt vor der Haustür zu verfolgen wäre. Das gilt auch für die Abschaffung des Asylbewerberleistungsgesetzes oder die Verbesserung der Unterbringung von Geflüchteten.
Probleme sollen nicht gegeneinander ausgespielt werden, aber vielleicht müssten neben der Seenotrettung und dem Camp Moria auch wieder die Menschenrechtsverletzungen in den Blick rücken, die jeden Tag in Deutschland begangen werden. Anders als für die Situation an den EU-Außengrenzen kann hier direkte Verantwortung zugeschrieben werden, da es sich in vielen Fällen um deutsche Gesetzgebung geht. Die von Jakob gelobten lokalen Bündnisse könnten dabei viel ausrichten – insbesondere, wenn sie sich nicht auf das Zuständigkeitspingpong zwischen Kommunen, Ländern und Bund einließen: Alle würden gerne etwas tun, können aber leider nicht, heißt es gerne. Gezielt Druck auf politisch Verantwortliche auszuüben, könnte mehr helfen als noch eine Demonstration.
Auch beim politischen Framing gibt es Verbesserungsbedarf: In den vergangenen Jahren haben sich die Debatten über Flucht und Asyl auf humanitäre Aspekte und Hilfe für Geflüchtete verengt. Für einzelne Kampagnen mag das strategisch richtig sein, insgesamt ist diese Entwicklung jedoch problematisch. Denn es reicht nicht, die Menschen aus den Lagern in Griechenland zu holen, auch wenn das ein dringend notwendiger erster Schritt ist. Es muss vielmehr darum gehen, ihr Recht darauf durchzusetzen, hier zu sein. Dazu muss Asyl auch über dezidiert linke Kreise hinaus wieder als Recht und nicht als Almosen begriffen werden.
Mit der immer weiter gehenden Einschränkung des Asylrechts ist auch das zu einem Abwehrkampf geworden, der aber dringend geführt werden muss.
Strategisch zu handeln, ist gerade dann extrem wichtig, wenn man das Bleiberecht für konkrete Menschen erwirken will. Jedes Kind, das aus dem Camp Moria ausreisen und aus humanitären Gründen nach Deutschland kommen kann, ist in der derzeitigen Situation ein kleiner Sieg. Lässt man sich aber zu sehr auf diese Debatte ein, wird es immer schwieriger, Asyl als Rechtsanspruch zu formulieren, den Menschen besitzen, unabhängig von der Laune der deutschen Volksseele und ihren eigenen individuellen Eigenschaften. Denn bei all der langwierigen und frustrierenden Arbeit, bei aller breit ausgerichteten Bündnispolitik, bei all den dauernden Abwehrkämpfen darf nicht vergessen werden, dass antirassistische Arbeit im Kern radikal ist und immer über das Bestehende hinausweist – es geht um Bewegungsfreiheit für alle Menschen. Lässt sich die Bewegung zu sehr auf die realpolitischen Debatte über humanitäre Hilfe ein, kann es passieren, dass diese Bewegungsfreiheit irgendwann nicht einmal mehr als Utopie formulierbar ist.
Ja, wir müssen, wie Lazarević schreibt, dass Schlimmste verhindern. Aber wir müssen dies nicht nur an den Außengrenzen, sondern auch in Deutschland. Dabei dürfen wir nicht vergessen, wofür wir eigentlich kämpfen – für eine Welt ohne Grenzen, in der kein Mensch illegal ist. Egal wie utopisch dieses Ziel erscheinen mag, es vor Augen zu behalten, ist wichtig, auch um in all den Abwehrkämpfen nicht verzweifeln.