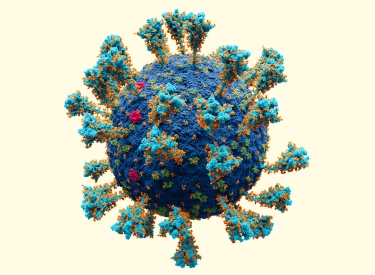Theorie und Praxis in Japans Vorkriegszeit
Am 14. Dezember 1923 versammelten sich 50 progressiv gesinnte Studenten auf dem Campus der Kaiserlichen Universität Tokio mit dem Ziel, ein sogenanntes Settlement-Haus im Arbeiterviertel Honjo zu gründen. Dabei handelt es sich um ein Konzept der sozialreformerischen Settlement-Bewegung, die in den 1880er Jahren in England entstanden war. Im Settlement-Haus, einer Art von Bildungs- und Gemeindezentrum, sollten Studenten zeitweise wohnen und für die Anwohner Sozialdienste wie ärztliche Versorgung, Rechtsberatung und Kinderbetreuung anbieten. Vor allem sollte dort eine Arbeiterschule eingerichtet werden. Der Vertrauensdozent des Settlement, der Jura-Professor Suehiro Izutarō*, sah sie im Kontext der sogenannten University-Extension-Bewegung. Diese war bereits in den siebziger Jahren des 19. Jahrhunderts, also einige Jahre vor der Settlement-Bewegung, in England entstanden mit dem Ziel, denjenigen, die nicht an einer Universität studieren konnten, eine Hochschulausbildung zu ermöglichen.
Bei der Eröffnung des neu gebauten Settlement-Hauses am 6. Juni 1924 führte Suehiro aus: »Es ist der beklagenswerteste Mangel der gegenwärtigen Gesellschaft, dass Intellektuelle und Arbeiter völlig voneinander getrennt sind. Welcher Bruchteil der 70 Millionen Landsleute hat die glückliche Gelegenheit, seinen Intellekt zu schärfen, indem er von einer der vielen Schulen Gebrauch macht?« Viele Proletarier könnten, obgleich sie von Natur aus Begabungen hätten, keine Bildung oberhalb der unzureichenden Grundschule in Anspruch nehmen. »Man muss sagen, dass dieser Zustand wahrlich nicht nur für die Proletarier selbst ein Unglück ist, sondern ein enormer Verlust für die Gesellschaft insgesamt«, so Suehiro.
In der von ihm gegründeten Zeitschrift »Avantgarde« gab der marxistische Theoretiker Yamakawa 1922 den Slogan aus: »In die Massen hinein!«
Die Professoren und Studenten an der Universität Tokio, die studieren konnten, weil sie in reiche Familien geboren wurden, oder denen aufgrund von glücklichen Umständen die Gelegenheit zum Studium zuteil wurde, seien also in der gegenwärtigen Gesellschaft die Monopolisten des Wissens. »Dass diese Monopolisten, während sie dem Himmel für ihr Glück danken, diejenige Zeit, die sie Tag für Tag, Stunde für Stunde, erübrigen können, jenen Armen schenken und somit ihr Wissen mit ihnen teilen, muss nicht nur eine bedeutungsvolle Arbeit für den Sozialstaat genannt werden, sondern ist sogar die selbstverständliche Pflicht jener glücklichen Monopolisten«, sagte Suehiro in seiner Eröffnungsrede.
Die Studenten, die die Arbeiterschule organisierten, an ihr lehrten oder als Tutoren tätig waren, verfolgten aber auch radikalere Ziele. Die meisten waren gleichzeitig Mitglied der marxistischen Studentengruppe »Gesellschaft des neuen Menschen« (Shinjinkai). Die Schulung der Arbeiter im Settlement-Haus war für sie politische Agitation mit dem Ziel der Stärkung der revolutionären Linken, die »Erziehung für und zur Arbeiterklasse«.
Dafür nahmen sie in Kauf, zeitweise im Slum zu wohnen und sich auch mit den Alltagssorgen der Arbeiter und Arbeiterinnen zu beschäftigen. Es verwundert, dass eine Institution, die sich die Agitation der Arbeiterklasse auf die Fahnen geschrieben hatte, erst 1938 zerschlagen wurde: Ab 1928 wurden linke Gruppierungen in dem immer repressiver agierenden autoritären Polizeistaat gewaltsam unterdrückt, im März wurden über 1 600 Aktivisten samt Führungsriege der illegalen Kommunistischen Partei Japans (KPJ) verhaftet.
Außerdem gilt die japanische Vorkriegslinke als einseitig theoretisch orientiert. Ihr Versäumnis, Theorie und Praxis zu verbinden, habe mit zu ihrer Niederlage und zum Aufstieg des Faschismus im Japan der dreißiger Jahre beigetragen. So urteilte etwa 1972 der US-amerikanische Historiker Henry D. Smith in seinem Buch »Japan’s First Student Radicals«, dem Standardwerk zur japanischen Studentenbewegung der Vorkriegszeit: »Obwohl die späten 1920er und frühen 1930er Jahre die Zeit der engsten Integration von linken Studenten und Arbeitern in der modernen japanischen Geschichte gewesen sein mögen, wurde die grundlegende Kluft zwischen Klassenantagonismus und kultureller Orientierung nur selten auf sinnvolle Weise überbrückt. Die Behauptung der elitären Studenten, sie repräsentierten ›einen Flügel der proletarischen Bewegung‹, war kaum mehr als eine Fiktion ihres romantischen Populismus.«
Die Niederlage der Linken im Japan der Vorkriegsjahre wurde noch zementiert durch die Praxis der »Konversionen«. Hunderte Mitglieder und Sympathisanten der illegalen KPJ schworen in den frühen dreißiger Jahren öffentlich dem Kommunismus ab, um ein Leben in Freiheit und ohne Repressionen genießen zu können. In einem weitverbreiteten Manifest verkündeten 1933 zwei prominente Führer der Partei aus dem Gefängnis heraus, die Orientierung an der Komintern, dem von der KPdSU angeführten internationalen Zusammenschluss kommunistischer Parteien, sei ein Fehler gewesen. Statt der weltweiten Solidarität aller Proletarier sei vielmehr ein japanischer Sozialismus anzustreben, der die außenpolitische Aggression – Japans Militär hatte 1931 die nordostchinesische Mandschurei überfallen und besetzt – rechtfertigte und die Monarchie befürwortete, de facto die Herrschaft einer Koalition von Offizieren, hohen Beamten, Großgrundbesitzern und Industriellen. Diesem Manifest schlossen sich viele Parteigänger an, wenn auch nicht alle. Eine kleine Gruppe harrte bis Ende des Zweiten Weltkriegs im Exil in der Sowjetunion oder in China aus. Daneben gab es auch Linke, die in Japan selbst versuchten, in neuen Bündnissen und Gruppen aktiv zu bleiben. Dazu gehörten auch zahlreiche Mitglieder des Settlement.
Industrialisierung ohne revolutionäres Proletariat
Der Weg Japans in die Moderne wies einige Besonderheiten auf, die dazu führten, dass die Idee eines japanischen Sozialismus Fuß fassen konnte. Die soziale Konstellation zu Beginn des 20. Jahrhunderts unterschied sich von der in den westeuropäischen Ländern, aber auch im zaristischen Russland. Die japanische Industrialisierung hatte erst spät eingesetzt. Der Anteil der Industriearbeiter an den Beschäftigten betrug noch 1905 lediglich 16 Prozent. Er stieg mit dem Wegfall der europäischen Konkurrenz auf den asiatischen Märkten im Zuge des Ersten Weltkriegs, verblieb aber auch in den zwanziger Jahren bei etwa 20 Prozent. Noch Mitte der dreißiger Jahre machten Arbeiter und Arbeiterinnen in Fabriken mit mehr als zehn Beschäftigten weniger als fünf Prozent der Bevölkerung aus.
Obwohl Japan in den zwanziger Jahren das am stärksten industrialisierte Land in Asien war, gab es kein klassisches Proletariat, das als Träger einer Revolution in Frage gekommen wäre.
Darüber hinaus stellten in dieser Frühzeit der Industrialisierung Mädchen und junge Frauen vom Land, die von ihren Familien bis zur Heirat einige Jahre in die Großstadt geschickt wurden, einen Großteil der Beschäftigten in den Fabriken. Der Frauenanteil in den Fabriken lag auch in den zwanziger und frühen dreißiger Jahren konstant bei um die 50 Prozent; durchschnittlich arbeiteten diese Frauen weniger als vier Jahre in der Industrie. Obwohl Japan in den zwanziger Jahren das mit Abstand am stärksten industrialisierte Land in Asien war, gab es kein klassisches Proletariat, das als Träger einer Revolution in Frage gekommen wäre. Eine der heftigsten Debatten innerhalb der Linken entbrannte daher auch um das Jahr 1930 über die Frage, ob Japan schon reif für eine proletarische Revolution sei. Das Gegenargument lautete: Da es noch keineswegs in der kapitalistischen bürgerlichen Gesellschaft angekommen sei, stehe vielmehr erst im Verein mit der Bourgeoisie eine bürgerliche Revolution auf dem Programm.
Offenbar gab es in Japan trotz der späten Industrialisierung und der noch schwach ausgeprägten Arbeiterklasse eine differenzierte linke Theoriebildung. Nicht nur wurden die Diskussionen der europäischen sozialistischen und kommunistischen Parteien aufmerksam verfolgt, Japaner nahmen auch an internationalen Treffen derselben teil und rezipierten theoretische Schriften mit philologisch-philosophischer Akribie. So wurde Karl Marx’ Einleitung zu den »Grundrissen der Kritik der politischen Ökonomie«, die 1903 erstmals publiziert worden war, schon 1927 ins Japanische übersetzt. Viele Ökonomen und Politikwissenschaftler nutzten ihre bei Aufenthalten in Deutschland erworbenen guten Sprachkenntnisse dazu, ihren Landsleuten Schriften des europäischen marxistischen Kanons vorzustellen. Anders als in vielen Ländern Europas konnten marxistische Theoretiker in Japan Professoren an staatlichen Universitäten werden – wo sie allerdings ab 1928 auch in Schwierigkeiten gerieten.
Das konventionelle Bild der stark theoretisch ausgerichteten japanischen Vorkriegslinken hat also seine Berechtigung. Dennoch zeigt das Beispiel des Settlement in Tokio, dass es auch andere Bemühungen und Strömungen gab. Immerhin handelte es sich bei der Universität Tokio um die angesehenste Hochschule des Landes, in der die zukünftige Elite in Wissenschaft und Bürokratie ausgebildet wurde. Als 1928 die »Gesellschaft des neuen Menschen« verboten wurde, nahm die Bedeutung des Settlement innerhalb der Linken noch zu, es wurde nach und nach zum letzten Unterschlupf für linke studentische Aktivitäten.
So auch für den 1914 geborenen Sekido Yoshimitsu. Er begann 1936, an der Universität Tokio zu studieren, und suchte Anschluss an linke Kreise. Am Settlement leitete Sekido einen Lesekreis für Arbeiter. Es war einer der wenigen Orte, an denen er in der zweiten Hälfte der dreißiger Jahre offen und kritisch über den Krieg in China reden konnte, berichtet Sekido der Jungle World.
Wegweisend für die Gründung des Settlement als Verbindungsglied zwischen linker Theorie und Praxis war zum einen die Erfahrung der organisierten Hilfstätigkeiten nach dem verheerenden Erdbeben in Tokio vom September 1923. Tausende Obdachlose kamen auf dem Campus der Universität Tokio unter und wurden von Studenten versorgt. Viele Settlement-Mitglieder der ersten Stunde rekrutierten sich aus Studierenden, die Erfahrung mit Hilfe für die Ärmsten der Stadt hatten.
Vermutlich wichtiger war der Kurswechsel, den der marxistische Theoretiker Yamakawa Hitoshi ein Jahr zuvor einzuläuten versucht hatte. Der 1880 geborene linke Intellektuelle stammte aus ärmlichen Verhältnissen und war als Schüler mit dem christlichen Sozialismus in Berührung gekommen. Obwohl er keine Universitätsbildung hatte, wurde er zu einem der aktivsten Autoren der Bewegung und war auch 1922 an den ersten Versuchen, in Japan eine kommunistische Partei zu gründen, führend beteiligt.
In der von ihm gegründeten Zeitschrift Avantgarde (Zen’ei) hatte Yamakawa im August 1922 den Slogan »In die Massen hinein!« ausgegeben. Das Ziel eines »Eintauchens ins Volk« der russischen sozialrevolutionären Narodniki hatte schon die »Gesellschaft des neuen Menschen« beeinflusst, wobei die in Russland eher auf Bauern gerichtete Bewegung in Japan auf städtische Arbeiter übertragen wurde. Yamakawa baute in seinem Artikel darauf auf, dass sich in der ersten Phase einer sozialistischen Bewegung nur eine Avantgarde innerhalb der proletarischen Klasse frei machen könne von »der Psychologie und Ideologie des Kapitalismus«. Diese Wenigen müssten viel Energie dafür aufwenden, ihr Klassenbewusstsein zu entwickeln und sich »ideologisch zu läutern«. Diese erste Phase habe die Arbeiterbewegung in Japan erreicht – und zwar sowohl die politische sozialistische Bewegung als auch die industrielle Gewerkschaftsbewegung.
Gegenwärtig begehe die Bewegung aber den Fehler, sich auf ihrem hohen ideologischen Niveau auszuruhen und auf konkrete revolutionäre Aktivitäten zu verzichten. Jeder Zwischenschritt auf dem Weg zur Abschaffung des Kapitalismus, der dieses Ziel nicht gleich erreiche, werde als Reformismus verächtlich abgetan. Erforderlich sei aber eine Orientierung an den Bedürfnissen der Arbeiterklasse selbst. »Wenn die Massen der proletarischen Klasse heute eine Lohnerhöhung von einem Zehntel Yen pro Tag fordern, ohne zugleich auch schon die Kontrolle der Produktionsmittel einzufordern, dann müssen wir unsere unmittelbare Bewegung auf diese tatsächlichen Forderungen der Massen gründen«, schrieb Yamakawa. Die Bewegung könne ihre Kraft nur aus diesen Massen ziehen.
Yamakawa bezog dieses Argument auch auf die parlamentarische Politik. 1922 galt zwar in Japan noch ein stark eingeschränktes Zensuswahlrecht, dennoch, so Yamakawa, könne die proletarische Bewegung es sich nicht leisten, Politik nur als bürgerliche Politik abzutun und zu ignorieren: »Wenn die Bewegung der proletarischen Klasse Desinteresse an allen politischen Fragen an den Tag legte, weil sie bürgerliche Politik einfach ideologisch ablehnt, dann bedeutet das, dem Kampf gegen die Bourgeoisie an der politischen Front einfach aus dem Weg zu gehen«, so Yamakawa. Wenn man das gegenwärtige System nur ideologisch ablehne, tue man ihm nicht einmal so sehr weh wie »mit einem Stich mit einem Zahnstocher«. Wenn die proletarische Klasse bürgerliche Politik wirklich ablehne, dann müsse sie »gegen bürgerliche Politik aktiv kämpfen und die Politik der proletarischen Klasse aktiv gegen die bürgerliche Politik in Stellung bringen«.
Zugleich betonte Yamakawa, dass sein Slogan »In die Massen hinein!« kein reformistisches Programm impliziere: »Wir dürfen jedoch keineswegs in den Massen, die noch unter der geistigen Dominanz des Kapitalismus stehen, aufgehen. Wenn die Avantgarde der Wenigen den ersten Schritt, den wir so aufwendig gegangen sind, einfach verwürfe und dadurch in den Massen aufginge, dann wäre dies nicht der erste Schritt nach vorne für die Bewegung der proletarischen Klasse, sondern ein Abstieg vom Revolutionismus in Reformismus und Opportunismus.« Diese präventive Argumentation konnte nicht verhindern, dass Yamakawa schon 1926 bei der neuen Führung der im Untergrund agierenden KPJ als »Reformist« in Ungnade fiel. Nun wurde, dem Kurs Lenins folgend, explizit die Partei als Träger der Avantgarde bestimmt, die das innerhalb der Partei ideologisch zu schärfende marxistische Bewusstsein von außen in die Arbeiterschaft hineintragen sollte.
Unterstützung durch liberale Akademiker
Die linken Studenten vermochte Yamakawa 1922 zu begeistern. Der Versuch, ab 1924 linke Praxis in einem Arbeiterviertel in Tokio zu verwirklichen, ging maßgeblich auf seine Anregung zurück. Im Settlement lebten seine Ideen auch nach der Neuausrichtung der Parteilinie 1926 weiter. Das Programm, sich an den Forderungen der Arbeiterklasse zu orientieren, wurde wohl nirgends deutlicher befolgt als hier, wo die theoretische Elite mit Arbeitern zusammenwohnte und -arbeitete.
Dafür war auch das pragmatische Bündnis mit nichtmarxistischen progressiven Kräften wichtig, angefangen mit drei innovativen Professoren der Universität, die eine Reform der Lehrpraxis anstrebten. Als Vertrauensdozenten halfen sie, Gelder für das Projekt aufzutreiben, und hielten ihre schützende Hand über das Haus, als es politisch immer riskanter wurde, offen links zu agieren. Diese Professoren waren keine Marxisten, sondern im weiteren Sinn Liberale. Alle drei hatten länger an der University of Chicago studiert und waren von progressiven sozialreformerischen Ansätzen aus dem angloamerikanischen Raum beeinflusst.
Der Jurist Suehiro Izutarō hatte als Spezialist für Arbeitsrecht noch am ehesten linke Affinitäten, blieb dem Marxismus aber sowohl theoretisch als auch parteipolitisch zeitlebens fern. Er sollte später Prominenz als Urheber des progressiven Arbeitsrechts Japans nach 1945 erlangen, mit dem Gewerkschaften erstmals eine prominente Rolle im Wirtschaftsleben des Landes einnahmen.
Sein Fakultätskollege, der später als »Vater des japanischen Familienrechts« geehrte Hozumi Shigetō, wurde nach dem Krieg sogar Richter am Obersten Gerichtshof des Landes. Als Adliger hatte er schon in der Vorkriegszeit Kontakte zu höchsten politischen Kreisen in Japan. Es ist maßgeblich auf ihn zurückzuführen, dass das Settlement überhaupt bis 1938 aktiv bleiben konnte. Sein Interesse an der Institution war vielleicht am ehesten hochschuldidaktisch: Wie Suehiro war ihm wichtig, dass die Jura-Studenten nicht nur Rechtstexte lesen, sondern schon während des Studiums praktisch tätig wurden. Hozumi leitete eine Rechtsberatungsabteilung des Settlement, mit der Suehiro, er und Jurastudenten den Anwohnern des Viertels bei Mietstreitigkeiten oder arbeitsrechtlichen Problemen kostenlos halfen. Die Abteilung war ebenso gefragt wie die kostenlose medizinische Behandlung, der Kinderhort und die Abendbetreuung für Schulkinder.
Der dritte Professor im Bunde war der Soziologe Toda Teizō, der seine Studenten empirische Untersuchungen im Stadtviertel vornehmen ließ. Toda ist als einer der Begründer der empirischen Soziologie in die Geschichte eingegangen, die in den zwanziger Jahren begann, die von der deutschen Tradition dominierte theoretische Soziologie abzulösen.
Die aus Sicht der studentischen Mitglieder wichtigste Abteilung des Settlement war aber die Arbeiterschule. Für deren Entstehung war neben dem Kurswechsel Yamakawas ein zweiter theoretischer Einfluss entscheidend. Die Idee, dass man eine eigene proletarische Kultur schaffen müsse, hatte sich auch in Europa verbreitet, ausgehend von der kulturrevolutionären russischen Proletkult-Bewegung, die zwischen 1917 und 1925 eine Kultur der neuen herrschenden proletarischen Klasse ohne bourgeoisen Einfluss erschaffen wollte. Insbesondere die mit der britischen marxistischen Plebs’ League, die linke Bildung unter Arbeitern fördern wollte, verbundene Variante von Proletkult wurde wiederum um 1920 in Japan rezipiert. Dort waren es zunächst gar nicht Marxisten, welche die Ideen von Proletkult attraktiv fanden, sondern Anhänger verschiedener Strömungen der Reformpädagogik, die zu dieser Zeit nicht nur in Europa en vogue war. Jedenfalls wurde in der Linken die Idee wirkmächtig, dass eine Agitation der Arbeiter über die Kultur effektiv sein könnte. Als zentral für eine proletarische Kultur galt den linken Studenten die Bildung, so dass es aus ihrer Sicht Sinn ergab, die Kräfte auf den Betrieb einer Arbeiterschule zu konzentrieren.
Beliebt und dann verhaftet
Die Arbeiterschule des Settlement nahm im September 1924 ihren Betrieb auf. Nach leichten Anfangsschwierigkeiten erfreute sie sich so großen Zuspruchs, dass in der zweiten Hälfte der zwanziger Jahre sogar Bewerberinnen und Bewerber abgelehnt werden mussten, weil nicht genügend Plätze zur Verfügung standen. Im ersten Jahrgang besuchten 64 Arbeiter und Arbeiterinnen die Schule und hörten Vorlesungen zu den Themen Arbeitsrecht, Gesellschaftsgeschichte, politische Theorie, Gewerkschaftstheorie, Wirtschaftsgeschichte der Arbeit, Probleme der Bauern und Ökonomie.
Ein Schwerpunkt lag darauf, bereits gewerkschaftlich Organisierte anzusprechen, die bis zur Hälfte der eingeschriebenen Schüler ausmachten, von denen etwa zehn Prozent Frauen waren. Die Unterrichtsinhalte waren nicht auf theorielastige Vorlesungen beschränkt, sondern bezogen praktische Probleme der Gewerkschaftsbewegung und der Arbeiteremanzipation ein. Die Arbeiter diskutierten mit den Studenten zu Themen wie »Für und Wider von parlamentarischen Bewegungen«, »Muss man die Zunahme der Frauenarbeit befürworten oder ablehnen?«, »Die Interessen von Bauern und städtischen Arbeitern verbinden?«, »Für und Wider von Streiks im öffentlichen Dienst«, »Für und Wider des Prostitutionssystems«, »Für und Wider des Eintritts in eine Gewerkschaft«, »Über die Geburtenkontrolle«, »Gespräche über das Sparen« und »Streiks in englischen Kohlebergwerken«.
Die Arbeiterschule schloss ihre Tore bereits 1932. Vermutlich war die Zunahme der staatlichen Repression der ausschlaggebende Faktor, die genauen Umstände sind nicht bekannt. Besonders die Festnahmen im März 1928 setzten der gesamten Linken schwer zu. Der Autor der einzigen japanischen Monographie über das Settlement, Miyata Shinpei, schätzt, dass die Hälfte der 1926 an der Arbeiterschule tätigen Dozenten bis 1929 verhaftet wurde. Mit einem reduzierten Programm konnte das Settlement noch einige weitere Jahre überleben.
Eine weitere Verhaftungswelle 1938, mit der die letzten noch nicht konvertierten Linken erfasst werden sollten, traf zahlreiche Mitglieder des Settlement, das als Ziel der Festnahmen in den Tageszeitungen genannt wurde. Es war es nicht mehr zu halten, auch die prominenten Professoren der Universität Tokio entzogen ihm nun ihren Schutz. Das Experiment, linke Theorie auch außerhalb der Fabriktore in soziale Praxis zu übersetzen, hat dennoch wichtige Erbschaften für die Nachkriegszeit hinterlassen, sowohl auf der Seite der Universitätsstudenten als auch auf derjenigen der ehemaligen Schülerinnen der Arbeiterschule.
Einige Studenten wurden Professoren und trugen in der Hochzeit des japanischen Nachkriegsmarxismus, die von den fünfziger bis zu den siebziger Jahren andauerte, zur Theoriebildung bei. Unter den ehemaligen Schülern befinden sich mehrere führende Persönlichkeiten der Gewerkschaftsbewegung und des linken Flügels der Sozialistischen Partei Japans (SPJ), der bis in die neunziger Jahre größten Oppositionspartei, die der seit Ende des Zweiten Weltkriegs meist regierenden Liberaldemokratischen Partei gegenüberstand. So stieg der 1904 geborene Yamahana Hideo, einer der frühesten Schüler der Arbeiterschule des Settlement, nach 1945 in die Parteiführung der SPJ auf. Sein Sohn war in den neunziger Jahren sogar Parteivorsitzender und sein Enkel Yamahana Ikuo bis 2021 Unterhausabgeordneter für den linken Flügel der Nachfolgepartei der SPJ, der Sozialdemokratischen Partei.
* Gemäß der im Japanischen üblichen Reihenfolge steht in diesem Artikel stets der Familienname zuerst.
Weiterführende Lektüre: Till Knaudt und Hans Martin Krämer, „Politische Agitation und Sozialreform im Alltag: Das ‚Settlement‘ der Universität Tōkyō in Shitamachi“. In: Stephan Köhn u.a. (Hrsg.) Tōkyō in den zwanziger Jahren. Experimentierfeld einer anderen Moderne? Wiesbaden: Harrassowitz 2017, S. 241–260.