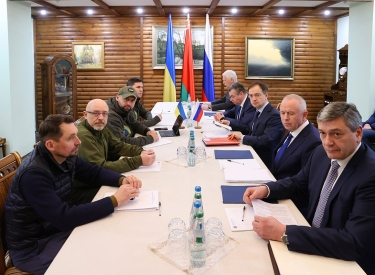Das Geheimnis des Deltas
Bald soll es in der Katastrophenregion wieder blühende Landschaften geben. »Die vom Sturm betroffenen Regionen werden sich im kommenden Jahr regeneriert haben, mit gedeihenden Bäumen und Pflanzungen«, behauptet die regimetreue Zeitung New Light of Myanmar. Die humanitäre Situation sei »nicht ernst«, und »die warmen und ermutigenden Worte des Staatsoberhaupts haben die niedergeschlagenen Opfer glücklich gemacht«.
Doch erst knapp einen Monat nachdem der Zyklon Nargis große Teile der Region südwestlich der Hauptstadt Yangon verwüstet hatte, begannen langsam die humanitären Hilfsarbeiten in den am stärksten betroffenen Teilen des Landes im Irrawaddy-Delta. Der Generalsekretär der Vereinten Nationen, Ban Ki-moon, hatte in direkten Verhandlungen mit General Than Shwe, dem Staatsoberhaupt Myanmars, am 23. Mai die Zusage erhalten, das Land für internationale Hilfe zu öffnen. Zwei Tage später versprachen bei einer Konferenz rund 40 Geberländer zwar 50 Millionen Dollar Soforthilfe. Unklar blieb jedoch, wie weit die Öffnung geht und wie nationale und internationale Hilfsleistungen koordiniert werden. Auch über die Rekonstruktions- und Rehabilitationsphase gab es keine Einigung. Für die Militärregierung SPDC (State Peace and Development Council) ist der Wiederaufbau der Schwerpunkt, sie hatte dafür während der Konferenz elf Milliarden Dollar gefordert.
Der Zyklon Nargis forderte nach offiziellen Angaben 78 000 Todesopfer, 56 000 Menschen werden vermisst und 2,4 Millionen wurden obdachlos. Bislang ist das wirkliche Ausmaß der größten Naturkatastrophe seit dem Tsunami Ende 2004 noch nicht bekannt. Nach der Katastrophe hat die Junta die Hilfsarbeiten von internationalen Nichtregierungsorganisationen, UN-Institutionen und ausländischen Regierungen systematisch behindert und erschwert. Wenige Tage nach dem Sturm ließ die Botschaft Myanmars in Bangkok wissen, dass sie für einige Tage geschlossen sei. Landegenehmigungen für Frachtflugzeuge, die Medikamente, Zelte, Nahrung und andere Hilfsgüter geladen hatten, wurden nur mit Verzögerung erteilt.
Erst etwa zwei Wochen nach dem Zyklon kamen die ersten Teams verschiedener internationaler Hilfsorganisationen endlich in Yangon an. Doch nachdem sie ihre Hilfsgüter entladen hatten, wurde den Hilfskräften der Zugang zu den am schwersten betroffenen Gegenden südwestlich von Yangon vollständig untersagt. Auch nach der Zusage Than Shwes, internationale Hilfsmaßnahmen zuzulassen, blieb der Zugang vor allem zu den Dörfern und Städten im Irrawaddy-Delta beschränkt, er unterliegt einer sehr strengen Kontrolle. So bestätigte Fréderic Penard, Verantwortlicher für Notfallhilfe bei Médecins du Monde in Paris, der Jungle World, dass »die Hilfsarbeiten weiterhin durch komplizierte Prozeduren und systematische Kontrollen erschwert werden«.
Beim Vorgehen der Militärs handele es sich »natürlich per definitionem um eine schwere Verletzung der ökonomischen, sozialen und kulturellen Rechte der burmesischen Bevölkerung«, sagte Benji Zawacki, Forscher bei Amnesty International, der Jungle World. Dies sei »nur der letzte Fall eines seit 40 Jahren anhaltenden Musters. Dem SPDC geht es ausschließlich um sein politisches Überleben. Er versucht deshalb mit allen Mitteln, jeden möglichen Einfluss westlicher Organisationen und Staaten in der Notfallhilfe einzuschränken.«
Für die Autokraten spielt das Los der eigenen Bevölkerung nur eine sehr untergeordnete Rolle. Seit 1962 gängeln Militärregierungen das Land. Ihr »Burmesischer Weg zum Sozialismus« ist einer Privatisierungspolitik gewichen, und für ausländische Investitionen wurde das Land geöffnet. Geblieben ist jedoch das Machtmonopol der Generäle, die 1988 und zuletzt im September 2007 Aufstände, die sich wiederholt an steigenden Preisen für Benzin und Lebensmittel entzündet haben, gewaltsam niederschlugen. Geblieben ist auch eine Ideologie der Abschottung, eine Furcht vor ausländischer Einmischung, die zuweilen paranoide Formen annimmt.
Unter der Leitung des Diktators Than Shwe, der seit 1992 regiert, verlegte die Junta von einem Tag auf den anderen ihren Regierungssitz mitten in den Dschungel nach Naypyidaw, wo sie auch Ban Ki-moon in aller Abgeschiedenheit empfing. Offenbar suchten die Generäle Distanz zur unruhigen Haupstadt, doch scheinen sie sich im Dschungel auch sicherer vor Invasoren zu fühlen. »Ich glaube, die Regierung fürchtet tatsächlich eine militärische Besatzung durch europäische Staaten oder die USA«, sagt Zawacki.
In eben dieser Tradition des nationalen Isolationismus und der geheimnisumwitterten Autokratie ließ die Junta seit Beginn der Katastrophe verlautbaren, dass sie selbst über die Möglichkeiten verfüge, die Situation zu meistern, und verzögerte systematisch internationale Hilfe. Als wäre nichts geschehen, ließ man am 10. sowie am 24. Mai die Bevölkerung in einem Referendum über die neue Verfassung abstimmen. Nach Angaben der Junta lag die Wahlbeteiligung bei 98,1 Prozent, und 92,5 Prozent hätten der neuen Verfassung zugestimmt. Sie festigt den politischen Einfluss der Militärs und schließt die Kandidatur der Oppositionsführerin Aung San Suu Kyi bei den für das Jahr 2010 geplanten Wahlen aus. Auch verlängerte der SPDC nur zwei Tage nach der Geberkonferenz den Hausarrest der Friedensnobelpreisträgerin Suu Kyi um ein Jahr.
Das Motiv für die isolationistische Politik ist offenbar die Angst der Junta, dass der humanitäre Apparat die Möglichkeiten für eine westliche Einflussnahme und die Unterstützung der Opposition verbessern könnte. Nur auf Druck des Verbandes südostasiatischer Nationen (Asean) und des UN-Generalsekretärs ließ sich das Militär auf eine Ausweitung der internationalen Hilfsmaßnahmen ein. Vor allem China hatte die Junta unterstützt, doch nach dem Erdbeben sogar Hilfe des japanischen Militärs angenommen. Damit habe »die Militärregierung ihre wichtigste Rückendeckung gegen internationalen Druck verloren«, meint der Exilburmese Ko Lin*.
Auch die Furcht vor erneuten Unruhen mag eine Rolle gespielt haben, große Teile der Bevölkerung hörten von ausländischen Radiosendern, dass es Hilfsangebote gab. Nun spekuliert der SPDC womöglich auf eine Stärkung seiner Position und eine Bereicherung des Militärapparats durch Bereitstellung der internationalen Hilfe. »Normalerweise zieht die Militärjunta aus jeder Situation mindestens einen politischen Vorteil«, sagt Ko Lin. Bis Freitag voriger Woche allerdings erhielt die Uno erst Zusagen für 63 Prozent der angeforderten 201 Millionen Dollar.
Gänzlich unberechtigt sind die Befürchtungen der Generäle wohl nicht, denn die westlichen Staaten werden versuchen, Hilfe für den Wiederaufbau des Landes mit Forderungen nach Demokratisierung zu verbinden, auch wenn Ban Ki-moon bei den Verhandlungen mit dem SPDC die politische und soziale Situation des Landes nicht einmal erwähnte. Die Junta dürfte dann versuchen, die Vereinten Nationen wie auch die NGO in die Nähe des westlichen Militärs zu stellen, wie das auch in verschiedenen anderen Ländern vor allem des Nahen und Mittleren Ostens passiert. Für unabhängige NGO wird sich dann die Frage stellen, ob sich unter diesen politischen Verhältnissen eine nicht parteiliche Form der humanitären Hilfe verwirklichen lässt.
* Name von der Redaktion geändert